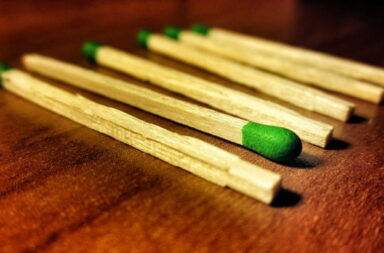Kernberg leitete das Cornell Hospital in New York, Dethlefsen gründete eine eigene Kirche. Bildbearbeitung © Carsten Börger. Hinweise zu den Bildrechten der Einzelfotos unten, unter Quellen
Es ist nun fast 50 Jahre her, dass in Deutschland ein sehr spezieller Funke zündete, einer, der die psychische Heilung revolutionieren sollte. Das freilich auf sehr verschlungenen Pfaden.
Als „Schock“ bezeichnete der damals junge Diplompsychologe, Hypnotherapeut und spätere Star der deutschen Esoterik das, was er da im Juni des Jahres 1968 erlebte. Der Begriff überschrieb das erste Kapitel seines ersten Buches, Das Leben nach dem Leben, das 1974 erschien. Der Erstling eines Mannes mit auffallend viel Selbstbewusstsein und revolutionären Ideen. So war eben die Stimmung der Zeit damals, könnte man sagen, aber gerade jener Thorwald Dethlefsen wurde davon, wenn überhaupt, anders erfasst. In einem angesehenen humanistischen Gymnasium in München fiel Dethlefsen bereits in sehr jungen Jahren dadurch auf, dass er stets in korrekter Kleidung und mit Krawatte in den Unterricht kam und mit dem politisch revolutionären Geist der Zeit eher wenig bis nichts zu tun hatte. Doch er war kein Mauerblümchen, denn reden, das fiel auf, konnte er ausgezeichnet, das sollte sich durch sein Leben ziehen. Revolutionär agierte er dennoch und schüttelte das Land in einigen Bereichen kräftig durch, ohne dass man dies heute zwingend mit seinem Namen verbindet. Als Mytheninterpret betonte Dethlefsen oft die Bedeutung der Katastrophe als Wendepunkt im Mythos und im Leben. Immer wieder schuf er selbst Neues, warf eigene Errungenschaften über den Haufen, bis er die Katastrophe im eigenen Leben erfuhr.
Worum es gehen soll
Es sind mehrere Geschichten, die hier erzählt werden sollen und ineinander greifen. Die Geschichte zweier ungleicher Weggefährten im Dschungel der Tiefenpsychologie, die sich von Ausgangspunkten auf die Reise machen, die kaum unterschiedlicher und weiter entfernt sein könnten, um irgendwo in den Tiefen des Waldes – ein Bild, das immer schon für das Unbewusste stand – auf ein Konzept zu stoßen, das psychische Heilung in ein theoretisch neues Licht rückt.
Es ist ein Stück Rekonstruktion einer Geschichte, die nur wenigen bekannt ist und die zugleich auch in die Zukunft blickt und ein noch immer ungewohntes Konzept präsentiert, das auf eine echte psychische Heilung im Unterschied zu einer Linderung von Symptomen abzielt. Nebenbei kann man sie auch als den ausstehenden dritten Teil der Reihe Karma und Psyche lesen. Auch vertiefen wir hier Betrachtungen, die wir in knapper Form schon einmal darstellten, etwa zur Reinkarnationstherapie oder zur Objektbeziehungstheorie, in einer Weise, die ein neues Licht auf alte Zusammenhänge werfen soll und damit eine Brücke zu Erkenntnissen der Gegenwart bildet. Das Spezial ist für Menschen gedacht, die Zeit und Lust haben, sich auf neue/alte Gedankengänge einzulassen, ihre Kenntnisse zu vertiefen und Enden, die seit längerem lose baumeln, versuchsweise zu verknüpfen. Wo zu eigenem Nachdenken angeregt wird, ist der Ansatz gelungen. Damit zurück in die Vergangenheit.
Der Schock
Was war das also für ein Schock, den Dethlefsen da erlebte? Er führte zu jener Zeit als Psychologiestudent hypnotische Altersregressionen mit seinen Kommilitonen durch. Altersregressionen sind schrittweise Rückführungen in verschiedene Lebensalter, in denen sich die Erinnerungen und das Erleben, aber auch die Handschrift und Stimme der Probanden altersgerecht verändern. Dethlefsen war damals unter anderem auch Zauberer auf der Bühne und ein hochbegabter Hypnotiseur. Es ist wohl die Mischung aus seinem Charisma und vor allem seiner Stimme gewesen, die es ihm als Hypnotiseur leicht machte. Dethlefsens Redetalent ist legendär. In späteren Jahren, als Dethlefsen um seine Fähigkeiten als Redner wusste, vielleicht ein wenig zu sehr inszeniert, doch schon der junge Dethlefsen ist bei wachsender Bekanntheit mit auffallender Quirligkeit, Schlagfertigkeit und auch Lust an der Gegenrede ausgestattet, die freilich als nicht selten brillanter, eigener Monolog daherkam, der auch schon mal zehn Minuten oder mehr dauern konnte. Im Rahmen jener hypnotischen Altersregressionen ging er an jenem Tag einfach, einer Intuition folgend, immer weiter zurück in der Zeit. Als der Proband ein Kind war, was scheinbar nichts mehr erlebte, forderte Dethlefsen ihn auf, noch ein wenig weiter zurück zu gehen und auf einmal war er wieder inmitten einer reichen Geschichte: nur betraf diese nicht mehr sein gewohntes Leben.
Der Proband erlebte sich auf einmal als ein anderer Mensch, in einer ganz anderen Zeit, mit ganz anderen Problemen. Dethlefsen wiederholte diese Experimente mit verschiedenen Menschen und deutete das Phänomen im Rahmen einer Wiedergeburt der Seele, als Beleg für Reinkarnation. Das war mindestens ungewöhnlich. Doch Dethlefsen meinte es ernst und es ging ihm dabei nicht allein um die Sensation, sondern tatsächlich um eine neue Möglichkeit für die Psychotherapie. Ihre Umrisse stellt er bereits in seinem ersten Buch vor, verbunden mit einigen heftigen, aber durchaus auch treffenden Polemiken gegen die Wissenschaft, die Medizin und die damals übliche Psychologie. Mitten in der Hochzeit der Verhaltenstherapie erteilt Dethlefsen dieser eine krachende Absage, scharf, pointiert und noch heute treffend.
Doch es ging ihm nicht um Kritik um ihrer selbst willen, Dethlefsen hatte ein alternatives Angebot dabei, bereit es herzuzeigen und sich dem Diskurs zu stellen. In groben Zügen war die Idee der Reinkarnationstherapie fertig. Der junge Dethlefsen war der Wissenschaft gegenüber zwar kritisch eingestellt, aber in einer durchaus konstruktiv herausfordernden Art und Weise. Das sprach sich dort herum und wurde aufgenommen und Dethlefsen bekam eine Antwort, obwohl er sich neben der Idee der Reinkarnation auch noch offen zur Astrologie bekannte. Zwei Jahre nach dem Erstling erschien das Buch: Das Erlebnis der Wiedergeburt. Das Nachwort schrieb mit Rainer Fuchs ein Psychologieprofessor, der Dethlefsens Angebot annahm. Fuchs ist zu dieser Zeit Direktor des Instituts für Psychologie und Erziehungswissenschaften der TU München, der ebenfalls zur Hypnose publizierte. Er möchte, dass Dethlefsen in seine Fußstapfen tritt und vielleicht war es einfach nur Pech, dass dies jetzt schon nicht mehr ging. Fuchs wollte, dass Dethlefsen den Weg des Experiments so konsequent wie bisher weiter geht. Doch Dethlefsen war inzwischen populär, die Menschen wussten, worum es ging, die Experimente konnten kaum mehr frei von Erwartungen stattfinden. So wurde, was hoffnungsfroh begann, bald zu einer unüberbrückbaren Differenz. Dethlefsen und die Wissenschaft, das passte nicht mehr. Die Tür ging zu, von beiden Seiten.[2]
Otto F. Kernberg: Ein Leben für die Wissenschaft
Als im Jahr 1987 ein Buch erscheint, in dem Edith und Rolf Zundel die Leitfiguren der neueren Psychotherapie vorstellen, da gebührt ihm das erste Kapitel: Otto Kernberg, ein Mann, der heute 88 Jahre alt ist und dessen große Sorge es noch immer ist, geistig stehen zu bleiben. 30 Jahre nach Edith Zundels Zeilen darf man sagen, dass Kernberg die Psychologie und vor allem die Psychoanalyse revolutioniert hat. Doch bereits in dem Text von 1986 heißt es:
„Eine Leitfigur der modernen Psychoanalyse ist Otto F. Kernberg. „Ich weiß gar nicht, wann der Mann schläft“, sagt Margret S. Mahler, eine der größten Theoretikerinnen der Psychoanalyse (sie ist vor kurzem gestorben), „er liest jedes Buch, hat jeden Film gesehen.“ Er ist Direktor am New York Hospital, White Plains, Professor der Psychiatrie an der medizinischen Fakultät der Cornell Universität, Lehranalytiker des Zentrums für psychoanalytische Ausbildung und Forschung an der Columbia Universität, Vizepräsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, Mitherausgeber des Journal of the American Psychoanalytic Association, und was er sonst noch macht, was er an Mitgliedschaften und Ehrungen auf seinen Namen vereint, füllt Seiten.“[3]
Und später:
„Die Eltern sprachen untereinander deutsch; er selbst hat immer deutsch gelesen. Auch jetzt kann man antippen, wo man will: Böll, Grass, Lenz, Wolfgruber, Bachmann, Handtke, Frisch, Dürrenmatt, Muschg – er weiß über alle Gescheites zu sagen.“[4]
Das zieht sich durch. Kernberg wird Präsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, die Seiten mit den Ehrungen wachsen, vor allem erwirbt er sich den Ruf mindestens in der Psychoanalyse alles zu wissen. Auf einem der vielen Vorträge, die ich von ihm hörte, sagt in der Fragerunde ein bedeutender psychoanalytischer Theoretiker, es lohne nicht, mit Otto zu diskutieren, da er sowie immer Recht habe. Die Familie des studierten Mediziners musste wegen der Nazis aus Wien emigrieren, Kernberg geriet nach Chile, studierte, heiratete und lernte dort die Psychoanalyse. Er wird überdies Professor für Psychiatrie und betont immer wieder, dass er sich explizit als Mann der Wissenschaft versteht.
Das ist als Psychoanalytiker nicht unbedingt gewöhnlich, aus mindestens zwei Gründen. Erstens, fühlen sich manche Psychoanalytiker über die Wissenschaft erhaben. Niemand weiß das besser als Kernberg und kaum einer kritisiert das schärfer, zuweilen auch ironisch, wenn er sagt, dass es auch Psychoanalytiker gibt, die nicht denken, sie seien Gott. Der zweite Grund ist, dass es in der Wissenschaft und auch in der sich stark auf sie berufenden und konkurrierenden behavioristischen Lerntheorie und Verhaltenstherapie, Abneigungen und Vorurteile gegen die Psychoanalyse gibt. Die Einschätzung des Philosophen Karl Popper ist, dass die Psychoanalyse gar keine Wissenschaft sei, eine Ansicht, die man mitunter heute noch hört. Schon damals lag der Irrtum auf Poppers Seite (siehe dazu auch: Wissenschaftstheorie und ihre Mythen), was aber nicht bedeutet, dass die allgemeine Einschätzung der vermeintlichen Unwissenschaftlichkeit der Psychoanalyse nicht ständig wiederholt wurde (manchmal eben bis zum heutigen Tag).
Doch Kernberg lamentierte nicht, sondern tat ganz einfach das, was angeblich nicht ging, nämlich die Psychoanalyse und die Wissenschaft unter einen Hut zu bringen. Insbesondere auf dem Gebiet der schweren Persönlichkeitsstörungen machte sich Kernberg einen Namen. Dachte man früher, es gäbe wesentlich zwei große Ebenen psychischer Erkrankungen, die Neurosen und die Psychosen, so erforschte Kernberg einen mittleren Bereich, der sich später als große eigene Welt herausstellte, mit dynamischen Verbindungen nach oben und unten, inzwischen wird das Gebiet der schweren Persönlichkeitsstörungen sogar selbst in leichte und schwere Formen unterteilt.
Nicht nur die Theorie, auch die Diagnose und Therapie trieb Kernberg voran, 1984 erscheint mit Schwere Persönlichkeitsstörungen: Theorie, Diagnose und Behandlungsstrategien ein voluminöses Werk von über 500 Seiten, ein Standardwerk über einen Bereich, den eben noch kaum jemand kannte. Kernberg ruhte nicht, wenn es darum ging auch Störungen zu therapieren, die zuvor als kaum erreichbar galten. Er blieb stets fair, Kleinkrieg zwischen den Disziplinen war seine Sache nicht, das beste Ergebnis soll entscheiden, unideologisch und zum Wohle des Patienten. Bei Vorträgen vor Kollegen rät er dazu, über den Tellerrand zu blicken und sich auch über die Fortschritte der Verhaltenstherapie, Psychopharmakologie und Hirnforschung zu unterrichten. Kernberg lebt ein Ideal der Wissenschaft, unideologisch, unpolitisch, jeweils nur offen dem Fortschritt der Erkenntnis verpflichtet.
Der Umgang mit Vorurteilen
Bei Otto Kernberg und Thorwald Dethlefsen ist der Umgang mit Vorurteilen, die ihnen begegneten, ähnlich und doch anders. Beide lassen sich nicht sichtbar irritieren. Kernberg ist auf dem Pfad der Wissenschaft unterwegs und setzt Ausrufzeichen, die Zahl seiner Bücher ist erheblich, sein Einfluss innerhalb der Psychoanalyse auch.
Auch Dethlefsen ist inzwischen längst nicht mehr irgendwer, sondern auf dem Weg zu einem Star der Psychoszene, gefragt auch in der Presse. Die Tür zur Wissenschaft ist zu, doch Dethlefsen zeigt sich ungerührt. Mit Schicksal als Chance kommt 1979 ein Buch auf den Markt, das zum Bestseller wird. In ihm schreitet die Distanzierung von der Wissenschaft weiter fort. Dethlefsen ist Esoteriker mit Leib und Seele, zu einer Zeit, als der Begriff weder verbrannt war, noch ein Hype um das Wort gemacht wurde. Populär machte die Esoterik Dethlefsen selbst. Er bekam inzwischen Verstärkung. Im „Institut für außerordentliche Psychologie“, in München, arbeiteten inzwischen einige Mitarbeiter, der bekannteste unter ihnen wird der junge Arzt Dr. Rüdiger Dahlke, der seit 1977 dabei ist. Rüdiger Dahlke ist derjenige, der es 13 Jahre an der Seite, des nicht immer einfachen Thorwald Dethlefsen ausgehalten hat. Doch die Formulierung ist zu düster, Dahlke erzählte, er habe Dethlefsen im Streit kennengelernt, sich 13 Jahre wunderbar mit ihm verstanden und sich dann im Streit wieder von ihm getrennt. Wo Dethlefsen provoziert, ist Dahlke eher moderat, ohne auf eine mitunter dezidierte Meinung zu verzichten, ein Brückenbauer und therapeutisch ein radikaler Pragmatiker, wie er selbst sagt. Der studierte Mediziner, der über die Psychosomatik des Asthma bronchiale promovierte und selbst auch eine Psychoanalyse durchlief, ist nicht erst durch den Tod Dethlefsens im Jahre 2010 zum Frontmann der deutschsprachigen Esoterik geworden. Die Zeit ihrer Zusammenarbeit ist für beide Seiten fruchtbar, in dieser erscheint das einzige gemeinsame Buch Krankheit als Weg ein Longseller, der Millionen mal verkauft und in zig Sprachen übersetzt werden wird, parallel wird das Konzept der Reinkarnationstherapie immer weiter ausdifferenziert.
Otto Kernberg hat die Möglichkeit seinen Einfluss als Präsident der größten psychoanalytischen Vereinigung geltend zu machen. Dethlefsen und Dahlke wählen einen anderen Weg, sie sprechen die Menschen direkt an. Spätestens in Krankheit als Weg ist das ganz explizit der Fall. Die beiden werden über „die Szene“, die wesentlich von ihnen begründet wird, hinaus bekannt. Das Buch Krankheit als Weg ist Reinkarnationstherapie für eine breitere Masse, ein Buch für all jene, die unter Krankheitssymptomen leiden und sich für deren Be-Deutung interessieren. Die Idee der Psychosomatik wird in dem Buch mit einem esoterischen Ansatz verknüpft, der das Konzept der normalen Psychosomatik überragt. Man arbeitet bewusst mit der Psychosomatik, die in den Begriffen unserer Alltagssprache überall zu finden ist. Wenn wir bei einer Erkältung „die Nase voll haben“, dann ist das ein Symptom, aber durchaus im doppelten Sinne des Wortes zu verstehen, wir haben, so die Botschaft, auch aktuell die Nase voll und holen uns das, was wir brauchen: Auszeit und Ruhe, über die Erkältung.
Das ist in Psychologie und Medizin als der sekundäre Krankheitsgewinn durchaus bekannt. Aber ist das alles? Sekundärer Krankheitsgewinn plus ein wenig esoterischer Überbau? Nein. Das Buch und die ganze Idee treffen den Nerv der Zeit. Es ist Medizinkritik, Gesellschaftskritik und Orientierungsangebot in einem. Das zu einer Zeit, als die Gesellschaft noch voller Übermut an die Idee des Fortschritts glaubte und daran, dass jede zukünftige Generation es besser haben würde, als die davor.
Dethlefsen und Dahlke waren frühe Mahner, sie warnten vor der Fortschrittsideologie und legten ihren zirkulären Ansatz offen. Anders gesagt: Ein Weg hat ein Ziel, an dem man ankommen möchte, Fortschritt hat kein Ziel, ist ein Trip. Wenn wir den Fortschritt erreicht haben, kommt noch mehr Fortschritt und man kommt nie und nirgends an. Man muss mal daran denken, die Bremse zu ziehen, inne zu halten, nachzudenken. Dargestellt haben sie dieses Thema exemplarisch an dem Bereich Krankheit und Heilung und das fulminant und selbstbewusst genug um einigen Wirbel zu verursachen und irgendwann selbst in den Fokus der Kritik zu geraten.
„Unwissenschaftlich“ hieß der Begriff mit dem man den ganzen Ansatz nun bezeichnete, doch Dethlefsen und Dahlke belieben ungerührt und die Szene derer, für die „unwissenschaftlich“ zu sein fast so etwas wie ein Gütesiegel wurde, wuchs erstaunlicherweise. In der Esoszene wurde das kalte, analytische und funktionale Denken mehr und mehr zum Feindbild und diese Szene hatte durchaus Einfluss. Doch parallel zum Einfluss wuchs auch die Kritik weiter und es entstanden organisierte Kritikergruppen, doch erstaunlich genug war, dass die Außenseiter solange Stand halten konnte. Zur Halbzeit lagen sie vorne, doch das sollte sich ändern. Gewann der Begriff „Esoterik“ anfangs durchaus an Strahlkraft und war es sexy esoterisch unterwegs zu sein, was bis zu eigenen Fernsehshows ging (dies allerdings schon ohne die beiden und als müder Abklatsch der ursprünglichen Ideen), so wurde der Begriff wie kaum ein anderer in der Folge diskreditiert und steht heute als Synonym für Unsinn.
***
Ganz anders Otto Kernberg. Für einen Psychoanalytiker, das sagten wir, ist es schon fast ein wenig eine Kuriosität ein dezidierter Mann der Wissenschaft zu sein. Doch diese Idee, dass sich beides ausschließt überhaupt im Kopf zu haben, zeigt vor allem eines: die kulturelle Stimmung der Zeit. Über Jahrzehnte hielt der Siegeszug der Wissenschaft an, Freud verstand sich ebenfalls als Mann der Wissenschaft, sah die Psychoanalyse als zwischenzeitliche Krücke oder Lückenfüller, weil die Neurologie zu seiner Zeit, mangels Möglichkeiten der Bildgebung und anderer Forschungsmethoden noch nicht so weit war. Ebenfalls 1968 bezeichnete Jürgen Habermas diese Haltung, in „Erkenntnis und Interesse“, einem Buch, das selbst zu einem Markstein deutscher Geschichte wurde, als einen Selbstirrtum Freuds. Die Psychoanalyse ist viel mehr und war es immer schon, als abgespeckte Neurologie und mehr als merkwürdigerweise selbst Freud ahnte. In den Worten von Habermas: „Die Psychoanalyse ist für uns als das einzige greifbare Beispiel einer methodisch Selbstreflexion in Anspruch nehmenden Wissenschaft relevant.“
Kernberg ist das alles bewusst, er nötigt der Psychoanalyse dennoch oder gerade deshalb die Wissenschaft auf. Ihre starken und idealen Seiten. Studien, Wirksamkeitsnachweise, Nachbesserungen, Freiheit von Ideologie. Kernberg will die stärksten Seiten der Wissenschaft leben und bewahren, bis heute. Er ist nicht nur überzeugt davon, dass die Psychoanalyse und mit ihr verwandte Formen wie aufdeckende, tiefenpsychologische oder psychodynamische Ansätze, hier bestehen können, er hat auch keine Scheu nachzubessern, Freud hier und da zu widerlegen und er weiß dennoch, dass mit der Widerlegung einiger Teilsegmente einer Theorie nicht die ganze Theorie obsolet ist, das gehört, Popper widerlegend, spätestens seit der Duhem-Quine-These ins Reich der wissenschaftstheoretischen Legenden. So konnte Kernberg den Weg der Wissenschaft konsequent weiter gehen, bis zum heutigen Tag.
Setting und Theorie der Reinkarnationstherapie
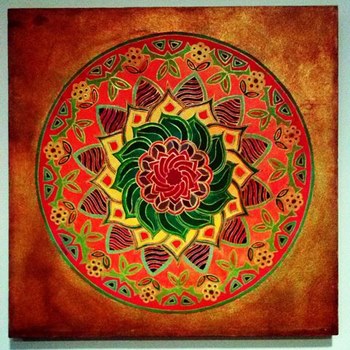
Mandalas, ein Ursymbol, spielen in dem Gesamtkonzept Reinkarnationstherapie eine Rolle. © JOSlash under cc
In der Reinkarnationstherapie fließt das gesamte frühe Ideengebäude von Dethlefsen und Dahlke zusammen und findet seinen praktischen Ausdruck. Sie besteht aus mehreren Elementen, wobei die Therapiesitzungen den Kern bilden, aber die Idee ist, eine Zeit von etwa vier Wochen zu haben, in der Therapie ein ‚rund um die Uhr Programm‘ ist. Das bedeutet, sich selbst, die eigenen Muster und Schattenbereiche unablässig in einem Raum oder einem „Feld“ der Ruhe, in dem man nicht abgelenkt ist, zu betrachten.
Die Reinkarnationstherapie wurde nicht im Studierzimmer ersonnen, sondern entstand immer auch spielerisch, empirisch, manchmal zufällig. So stellten Dethlefsen und Dahlke fest, dass in der ersten Münchener Zeit jene Patienten, die von außerhalb kamen und im Hotelzimmer lebten bessere Therapieerfolge hatten, als die Münchener selbst, die wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückkehrten. Fortan ließ man auch die Münchener während der Therapiezeit im Hotel wohnen, was die Erfolge auch bei diesen vergrößerte.
Der Idee der Psychosomatik folgend, dass ein verstopfter Mensch auch im übertragenen Sinne dicht ist und macht und wohl ebenfalls aus therapeutischer Eigenerfahrung, entwickelten sich das begleitende Fasten zum integralen Bestandteil der Therapie. So kam Baustein zu Baustein. Ein wesentlicher: Auf die Hypnose wird verzichtet. Obwohl Dethlefsen hier überbegabt ist. Das macht nicht jeder. Statt dessen gehört nun lediglich eine leichte Tranceinduktion zum Konzept. Der Patient ist entspannt, aber bewusst, liegt, die Augen sind geschlossen. Das reicht. Das „Bildern“, also das Verwickeln in Erlebnisse, in denen Bilder und emotionale Identifikationen auftauchen, die sich als frühere Leben ausgeben, klappt dennoch. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Elemente zur Reinkarnationstherapie hinzu, die heute stabil zur vier Wochen Reinkarnationstherapie gehören:
Die Therapiesitzungen selbst, das Fasten, Sitzungen mit verbundenem Atem, Ruhe und Selbstbesinnung, Wiedergabe der Therapiesitzungen in eigenen Worten und Bildern, Achtsamkeit im Bezug auf die eigenen Träume, Ideen, Phantasien während der Therapiezeit, Verzicht auf Ablenkung und intellektuelle Beschäftigungen, stattdesssen lieber die Beschäftigung mit Märchen und Mythen oder dem Ausmalen von Mandalas.
Das theoretische Konzept der Reinkarnationstherapie liegt seit Schicksal als Chance offen vor. Der Patient kommt mit einem Problem, körperlicher oder psychischer Art. In seinem Vortrag über Reinkarnationstherapie macht Dethlefsen klar, dass es ihm um die Überwindung einer emotionalen Distanz geht, die zwischen der konkreten Situation und dem dahinterliegenden eigenen Muster liegt und darum, das eigene Muster jenseits und in der konkreten Situation sehen zu lernen.[4] Hat jemand Eheprobleme, geht es in der Einzeltherapie immer darum, den eigenen Anteil daran zu finden. Bleibt man bei der konkreten Situation, hat man häufig das Problem, dass jemand sagt: „Die Idee ist sicher gut, aber das geht bei mir leider nicht, sie kennen meine Frau nicht!“ Bevor man nun die Psyche der Frau diskutiert und ob diese nun wirklich so ganz anders ist, als alle andere Menschen oder nicht, will sich die Reinkarnationstherapie ganz von diesen Verwicklungen im Konkreten lösen und fokussiert sich auf die eigene Rolle, das eigene Muster in und hinter diesem Konflikt.
In diesem „Wissen Sie, das ist mit meiner Frau nicht zu machen“, was steckt da eigentlich für eine Aussage drin? Resignation, Angst vor eigenen Forderungen und den Konsequenzen, Bequemlichkeit? Was sagt es über mich aus, dass ich so eine Einstellung habe? Und sollte die Frau tatsächlich sehr anders als alle anderen sein, was sagt es über mich aus, dass ich genau diese Frau attraktiv finde? Der Ball wird immer wieder zurückgespielt in die eigene Psyche und die Reinkarnationstherapie nimmt das sehr ernst.
Das kann man auf weitere zwischenmenschliche Situationen übertragen, den Nachbarn, den Chef, über den man sich ärgert. Aber warum ärgert mich genau dieser Mensch und mehr noch: Warum traue ich mich nicht an der Situation was zu ändern? Gute Gründe gibt es immer: Eine Familie, die zu ernähren ist, Sorge um den Arbeitsplatz, da ist vieles denkbar und mitunter auch realistisch, aber Dethlefsen und Dahlke geht es nicht darum eine Liste zu erstellen, die ausführlich begründet, warum alles so bleiben muss, wie es ist, sondern es geht darum, anhand dieser Gegebenheiten das eigene Muster, sich selbst zu erkennen. So bin ich, so denke und agiere ich, das sind meine Motive. Der therapeutische Anspruch ist, dass man dies erkennt und sieht und dieses abstrakte Muster auf alle Lebenslagen übertragen kann. Man sieht, so die Idee, die eigene Rolle, den eigenen Anteil beim Partnerschaftskonflikt oder seiner krampfhaften Vermeidung, aber auch beim Ärger über den Chef, den Nachbarn und in der Haltung, die man zu weltanschaulichen Fragen einnimmt.
Worum es im Kern geht
Die Idee dahinter ist einfach: Man will dem Patienten eine Projektionsfläche nach der anderen nehmen. So sagt es Dethlefsen wörtlich und weist immer wieder und pointiert darauf hin, dass die Projektion von Schuld eines der Hauptprobleme unserer Zeit ist. Ob nun Gene, Bakterien, Nachbarn, die Erziehung, der Kapitalismus, die Gesellschaft, Umweltgifte, der Partner, Chef oder Elektrosmog, die Gründe für die eigene „Unschuld“, werden immer gesucht, kombiniert und gefunden. So, dass am Ende immer genau einer übrig bleibt, der mit der ganzen Sache rein gar nichts zu tun hat: der Betreffende selbst. Das ist schon insofern eine etwas komische Situation, weil „die ganze Sache“, um die es hier geht, das eigene Leben ist. (Vergleiche dazu auch: Die eigenartige Lust an der Degradierung)
Wie weit man das nun treiben will, ist Geschmackssache. Kaum jemand würde wohl heute die Aussage unterschreiben, dass es keine Umwelt gibt und diese uns auch nicht tangiert. Dethlefsen selbst zieht diese scharfe Form aus Schicksal als Chance zurück, wenn in Krankheit als Weg formuliert ist, dass die Medizin in dem was sie tut durchaus gut ist und recht hat, dass es aber da noch eine andere Seite gibt, eine psychische, die viel zu wenig betrachtet wird.
Und hier ist ein Punkt wichtig: Wenn man sich die Frage vorlegt, was all das, was mir geschieht, denn eigentlich mit mir zu tun hat, dann kann man nicht an irgendeinem Punkt aussteigen und sagen: „Na, das waren meine Eltern“ oder diese Infektionskrankheit damals. Nicht, wenn man diesen Weg beschritten hat, sonst bleibt es bei der Willkür. Ansonsten beschäftigt man sich mit dem, was im Grunde nicht weh tut und verharrt im Banalen und Gewohnten. „Ja, da hatte ich auch Stress, kein Wunder, dass ich mich erkältet habe, Stress und Immunsystem, man kennt das ja.“ Doch dort, wo der dicke Hund begraben liegt, setzt man dann wieder die Anderen, die Umwelt, als Verantwortliche ein.
Die Grundidee ist jedoch, dass Krankheit kein Zufall ist, sondern einem Muster folgt, was immer mit dem Betreffenden selbst, mit seiner Psyche zu tun hat. Jeder kennt den Durchfall bei Prüfungen, der „Schiss“ ausdrückt, wir wissen, dass die Hände oder die Stimme zittern können, dass sich die Schulter- und Nackenmuskeln verspannen können, wenn wir gestresst sind, dass der Atem nicht mehr frei fließt. Die Zusammenhänge sind allgemein anerkannt. Dethlefsen und Dahlke gehen weiter und betrachten auch jene Krankheiten als psychosomatisch, die üblicherweise nicht mehr dazu gezählt werden. Etwa Infektionen durch Bakterien oder Viren. Es wird nicht geleugnet, dass es Bakterien oder Viren gibt, die Behauptung steht im Raum, dass diese uns ohne innere Bereitschaft, ohne Resonanz zu dem Muster, was die Krankheit ausdrückt, nichts anhaben können.
Eine steile These, die hier aber längst noch nicht ihr Ende findet. Über den medizinisch nachgewiesenen Weg, dass Stress ja die Immunlage verschlechtert kann man diesen Ansatz noch verteidigen, aber der Ansatz der Reinkarnationstherapie und aus dem gemeinsamen Buch Krankheit als Weg geht noch um einiges weiter. Unfälle, Krebs, AIDS, angeborene Behinderungen, sie alle werden unter dem Aspekt betrachtet: Was hat es mit mir und meiner Psyche zu tun?
Zunächst erscheint es aberwitzig, buchstäblich alles durch diese ins Esoterische erweiterte psychosomatische Brille anzuschauen, aber wenn wir den Spieß einmal umdrehen und fragen, woher wir denn so genau wissen, welche Krankheiten nun eindeutig psychosomatisch sind und welche nicht und nach welchen Kriterien wir das beurteilen, dann stellen wir fest, dass wir das so genau eigentlich auch nicht wissen. Es ist eine Gewohnheit, die uns den Skiunfall und die Behinderung als eindeutig nicht psychosomatisch, die Allergie und das Schmerzsyndrom aber als durchaus psychosomatisch erscheinen lässt. Doch es ist nicht die mangelnde Differenzierungsmöglichkeit die Kritiker irritiert und verärgert, sondern die Idee, dass, wenn man von psychischen Mustern redet, jemand der krank ist nun vorgeblich auch noch Schuld zugesprochen bekommt, die Schuld dafür, dass er krank ist. Wir stellen dies einen Augenblick zurück, widmen uns jenem Punkt jedoch.
Was ist eigentlich Heilung?
Heilung gehört zu jenen Begriffen, mit denen wir oft umgehen, in der Gewissheit recht genau zu wissen, was damit gemeint ist, doch wie so oft sind es gerade die selbstverständlichten Begriffe, die sich als sperrig erweisen. Was ist Krankheit, was Gesundheit? Was ist nur Symptomlinderung und was Heilung und gibt es überhaupt einen Unterschied? Philosophen kommen da ins Grübeln, beschränken wir uns auf die Varianten von Heilung.
- Heilung aus medizinischer Sicht
Heilung aus medizinischer Sicht fällt eng mit der Linderung oder Abwesenheit von Symptomen zusammen. Liegt eine Entzündung vor, so ist man krank, ist die Entzündung weg, ist man wieder gesund, der Vorgang als solcher ist die Heilung. Im Zentrum dieser Betrachtung besteht ein primär biologisches Modell von Krankheit und Gesundheit. Es gibt einen idealen Status der Gesundheit (dem man mehr oder weniger weitreichend entspricht), ist dieser Status verändert, ist man krank, wird der Status von zuvor (oder der des Ideals der Medizinbücher) weitgehend oder ganz wieder hergestellt oder erreicht, so ist das Heilung.
- Heilung aus psychologischer Sicht
Heilung aus psychologischer Sicht ist dem nur in bestimmten Aspekten ähnlich. Wer plötzlich unter psychischen Symptomen leidet, die er zuvor nicht hatte oder kannte, der hat zwar oft selbst den Wunsch, alles möge wieder so werden, wie es vorher war, als man alles als unbeschwert empfand, doch Psychotherapeuten wissen, dass das nur selten der Fall sein wird.
Zwar gibt es leichte Traumatisierungen, die man im wesentlichen durch schnelle Übung überwinden kann. Ein Autounfall, der einem in den Knochen sitzt oder der berühmte Sturz vom Pferd, bei dem alle wissen, dass es wichtig ist, möglichst schnell wieder weiter zu reiten. Gelingt das, ist in aller Regel das meiste wieder wie zuvor, bei schweren Traumatisierungen oder tiefsitzenden Mustern, die auf einmal durchdrücken, ist das anders. Heilung ist hier nicht ein Zurück, in einen Zustand davor, sondern das was erfahren wurde bleibt und muss nun integriert werden in einen neuen, größeren, oft anderen Zusammenhang. Psychische Heilung heißt hier mehr zu werden, integrierter zu werden, zu wachsen. Man ist danach ein anderer Mensch, aber nicht umprogrammiert sondern man ist einerseits noch ganz der Alte und zugleich mehr, jemand, der reifer geworden ist, durchs Leid gelehrt.
- Heilung aus psychosomatischer Sicht
Heilung aus psychosomatischer Sicht befindet sich irgendwo in der Mitte, schon weil sie körperliche Erkrankungen immer auch als Symbol, Signal oder Hinweis versteht. Auch wenn es eigentlich „nur“ der Rücken oder der Kopf sind, die schmerzen, das Immunsystem, das irgendwie verrückt spielt oder der Magen, der rebelliert, wenn man sich zum Kotzen fühlt. Theoretiker und Praktiker der Psychosomatik wissen, dass Körper und Psyche nicht voneinander getrennt sind und praktisch alles – nicht nur jede Krankheit – psychosomatisch ist, die Grundidee ist, dem Körper die Stellvertreterrolle abzunehmen, indem man das, was er ausdrückt, bewusst lebt.
Psychische Heilung ist hier also auch körperliche Heilung, bzw. die Erkenntnis, dass man den Körper auch über die Psyche heilen kann und umgekehrt. Heilen hier eher im Sinne der Psychologie, indem man im Bewusstsein größer wird und das erkennt und ins Leben integriert, worauf der Körper einen hinweist.
Die Objektbeziehungstheorie
Theoretische Überlegungen schrecken oft ab, weil man hier Assoziationen von weltfremd und dröge hat, tatsächlich sind sie spannend, wenn man innere Zusammenhänge erkennt und das kann man hier, bei diesen ungleichen Geschwistern, exemplarisch aufzeigen.
Otto Kernberg ist kein reiner Objektbeziehungstheoretiker, aber diese Theorie beeinflusste ihn maßgeblich. Die Grundidee der Objektbeziehungstheorie ist einfach. Wenn sich zwei Menschen begegnen, dann steht diese Begegnung unter dem Einfluss eines Affektes, der sie in der Mitte verbindet. Es kann sein, dass wir Menschen begegnen, die affektiv recht neutral, ausgewogen oder schwach auf uns wirken, die haben wir dann sehr schnell wieder vergessen. Es sei denn, wir begegnen ihnen häufiger, vielleicht in der Uni oder bei der Arbeit.
Sind diese Ausschläge schwach, ist der andere einfach einer von vielen, die uns im Leben eben so begegnen. Bei anderen Menschen sind die Ausschläge heftiger. Diese Menschen sind uns sympathisch, wir bewundern sie, sie stoßen uns ab oder langweilen uns maßlos. Die Erinnerung an und die Phantasien über sie bleiben eher haften, je öfter wir ihnen begegnen. Die Affektforschung hat ergeben, dass optimale Beziehungen gemäßigt sind, das heißt, stabil und emotional verlässlich, mit einem eher breiten Spektrum an Affekten und Emotionen, die man miteinander leben und austauschen kann, die das Vertrauen und die Sicherheit geben, auch die Grenzbereiche des Lebens miteinander zu erkunden.
Aber optimal läuft es eben nicht immer und besonders brisant sind die sogenannten Spitzenaffekte, die mindestens einen der Beteiligten überfordern und die Beziehung zu ihm einerseits verzerren, andererseits aber auch intensivieren. Finden gelegentliche Begegnungen unter dem Einfluss von Spitzenaffekten statt, vor dem Hintergrund einer stabilen Psyche und das heißt aus Sicht der Objektbeziehungstheoretie: vor dem Hintergrund vieler normaler, stabiler, verlässlicher Beziehungen, so können auch gelegentliche Spitzenaffekte einigermaßen gut integriert werden. Brisant wird es, wenn verzerrte oder schwer pathologische Beziehungen, in denen Spitzenaffekte reichlich sind, häufig oder dauernd auftauchen, weil diese häufigen Spitzenaffekte, die Entwicklung normalgesunder Beziehungen deutlich behindern und irgendwann zerstören. Das führt zu dem, was man schwere Persönlichkeitsstörung nennt, oder bei einem einmaligen, sehr intensiven Erleben, das oft mit Lebensgefahr oder Todesangst assoziiert ist, zu einer Traumatisierung und in der Folge dann oft zu einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Spitzenaffekte brennen sich einfach mehr und tiefer in die Psyche ein, wie ein glühendes Eisen in die Haut. Und was brennt sich da genau ein? Ein Dreiklang: Ein Bild des Selbst, eines des anderen und in der Mitte verbindend und trennend, ein Affekt. Ein Affekt, der zum Beispiel Wut heißen kann: Trennend dadurch, dass der eine wütend ist und der andere der Adressat oder das Opfer der Wut. Nun kommt eine Stelle an der man aufpassen muss: Aus Sicht der Objektbeziehungstheorie wird nicht nur das Selbstbild integriert, sondern, der gesamte Komplex: das Selbstbild, das Bild des anderen und der Affekt in der Mitte (wie ihn das Selbst und der andere jeweils erleben).
Wer jetzt sagt: „Naja, und?“, hat im Grunde recht, denn die Brisanz dieser theoretischen Aussage erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Deshalb wollen wir sie erklären: Wenn wir ein Bild vom Selbst und unserem Empfinden, sowie vom anderen und dessen Empfinden integrieren, dann folgt daraus, dass beides in uns ist und im eigenen Blick auf die Beziehung zu diesem Menschen wohnt. Wenn ich täglich gequält und gedemütigt werde, ist in mir das Bild eines gequälten Opfers und eines lustvoll quälenden Sadisten. Und es ist sonnenklar, dass, wenn ich gequält werde, ich mich natürlich als das Opfer empfinde, was ich de facto ja auch bin. Das heißt, ich bin mit dem Bild des Opfers identifiziert, ich bin das Opfer, der andere der Täter, der Quälende, der Sadist. Der bin ich nicht. Und doch ist das Bild des anderen ebenfalls in mir.
Wenn Heilung wirklich die Angliederung oder Integration unbewusster Anteile ist – und das ist aus psychoanalytischer, psychodynamischer und tiefenpsychologischer Sicht, aus gutem Grund die Annahme – dann bringt es psychisch und psychotherapeutisch wenig, wenn ich ständig betone, dass ich ein armes Opfer bin. Denn psychologisch (nicht juristisch, faktisch oder lebenspraktisch!) bin ich ja bereits mit dem Bild des Opfers identifiziert. Es geschieht nichts Neues, wenn ich mich noch mehr als Opfer sehe, denn das tue ich ja bereits. Der Schatten, das Unbewusste ist es, was als das fundamental Neue und bisher Unbekannte integriert werden muss. Das mir tatsächlich Unbewusste ist der Täter. Sind seine Motive. Man kann es einfach nicht verstehen, wie ein Mensch anderen Menschen so etwas antun kann. Wie der Täter mir so etwas antun konnte. Das ist einem fremd, man selbst käme nie auf diese Idee, kann noch nicht mal im Ansatz nachempfinden, was solche kranken Menschen motiviert. Oder doch?
Gehen wir einen Schritt zurück. Wenn tatsächlich der gesamte Komplex von Selbstbild, Bild des anderen und der Affekt in der Mitte integriert wird, dann sind in jedem von uns die ganze Beziehung und beide Akteure und ihre Motive verinnerlicht. Ich finde demnach also auch den Anderen und seine Motive in mir. In den meisten Situationen ist das ohne Brisanz. Wenn wir eine alte Freundin wieder treffen, die wir lange aus den Augen verloren haben, spontan in ein Café gehen und uns über die letzten Jahren unterhalten, dann erleben wir zum einen unser eigenes Gefühl. Eine Mischung aus freudiger Neugierde, Sympathie, Überraschung und dergleichen. Wir erkennen aber auch, wie sich die Freundin fühlt. Dass sie ebenso freudig überrascht ist, wir erkennen, wo sie vielleicht immer noch ganz die Alte ist, auch wo sie irgendwie verändert wirkt. Traurig oder inzwischen etwas abgehoben, vielleicht gereift und selbstbewusster, abwesend und zerstreut, wir spüren was im anderen los ist, wie in etwa seine Gefühle sind. Was wir an ihr wahrnehmen ist aber immer unsere Interpretation.
Beziehungen sind immer auch Projektionen

Im Affekt wechselseitiger Sympathie vereint. © richardhe51067 under cc
Natürlich sind es immer auch Projektionen, die mich die Stimmungslage des anderen erkennen lassen. Projektion heißt, dass ich etwas mit einem Thema zu tun habe, mir dies aber gar nicht unbedingt selbst bewusst ist. Was mir hingegen irgendwann bewusst werden kann, ist, dass mich ein Thema, eine bestimmte Verhaltensweise, besonders stört. Meist genau jene, die ich dummerweise auch noch an allen Orten sehe, der ich ständig begegne. Das kann sowohl etwas sein, was mich ärgert, als auch etwas, was ich bewundere. Meistens ist es der Ärger, der uns noch mehr auffällt. Auf einmal erscheinen uns alle Menschen geizig, aggressiv oder hysterisch.
Projektion ist nie (oder nur in sehr wenigen Fällen) reine Phantasie. Wenn man der alten Freundin sagt, dass sie irgendwie traurig wirke, dann kann es sein, dass sie tatsächlich traurig ist, weil vor wenigen Tagen ihr geliebtes Haustier verstarb. Die Empfindung hatte also einen realen Hintergrund, der schnell geklärt ist. Es könnte aber auch sein, dass andere Menschen diesen Anteil von Trauer gar nicht bemerkt oder angesprochen hätten, man selbst hat aber diese Affinität zu bestimmten Gefühlen. Man ist dann sehr hellhörig und feinfühlig, für eben dieses Thema, diese Affekte und Stimmungen, ist damit in besonderer Resonanz. Der Mechanismus ist immer derselbe. Ich sehe das im anderen, was eigentlich (auch) zu mir gehört, nur in mir kann ich es nicht finden oder erkennen und wenn, dann bei weitem nicht so ausgeprägt und umfangreich. Der wichtige Punkt ist, dass Menschen, die ein Gefühl, eine Eigenart in sich nicht finden, diese nicht bewusst vor der Welt verstecken und klammheimlich leben, sondern das Thema ist ihn ihnen wirklich verdrängt. Das heißt, sie haben die Überzeugung, mit ihnen hätte das Verhalten der anderen (die sind ja so, sie tun und sagen das ja) nichts zu tun. Das macht die Angliederung so schwer, man fühlt es wirklich nicht in sich, aber das Thema: Aggression, Gier, Sexualität, Neid, Großspurigkeit … begegnet einem einfach ständig.
Projektionen sind normal. Zumindest ein Stück weit. Wir sind nicht in der Lage genau zu definieren, wo eine Projektion beginnt und endet. Ständig verinnerlichen wir Bilder von anderen und stellen diese internalisierten Bilder als Projektion oder Externalisierung wieder nach außen, gleichen sie mit der Welt ab, so bleibt unser Weltbild dynamisch. Das ist gesund und in Ordnung. Es kann gut sein, dass es uns selbst auffällt, dass wir bei einem Thema sensibel reagieren (bei vielen anderen hingegen nicht), es in besonderer Weise bemerken und sogar unsere Mitmenschen fragen: „Siehst Du das denn nicht?“ Die Antwort ist für den, der fragt, oft enttäuschend, denn die anderen sehen es meistens sehr wohl: Es stört sie nur nicht sonderlich und genau das macht den Unterschied. Wer sagt: „Ja, klar ist er so, aber so war er doch immer“, ohne dabei groß erstaunt, erregt oder anklagend zu sein, hat mit diesem Thema kein eigenes Problem. Derjenige, der projiziert, aber sehr wohl. Unabhängig davon, ob man der einzige Mensch auf der Welt ist, den etwas stört, ärgert, wütend macht oder irritiert oder ob man Millionen Andere hinter sich weiß, es bleibt das eigene Thema. Und man sieht es nur über diesen Umweg oder Spiegel der Umwelt.
Noch stärker ist dies bei der projektiven Identifikation, einer Verschlimmerung der Projektion. Das Thema ist nicht völlig auf einen anderen Menschen projiziert, sondern man hängt ein Stück weit mit drin. Aber auch nicht in der Weise, dass man empfindet, dass es das eigene Thema ist, sondern man projiziert hier so gut wie immer Spielarten der Aggression auf andere Menschen und fühlt sich von diesen zugleich gemeint und bedroht: „Ich weiß genau, was der vorhat.“ Man kennt die Absichten und Motive des anderen, meint genau zu wissen, was den anderen motiviert und kann sogar erklären, wie durchtrieben er ist … warum eigentlich? Woher weiß man das? Weil es die eigenen Empfindungen sind, die man projiziert, deren emotionalen Anteil man aber nicht ganz los wird. Man hat dieses Grundgefühl bedroht zu sein und meint in der projektiven Identifikation die Wut und Durchtriebenheit des anderen fast körperlich zu spüren. Und doch ist man auch hier wieder überzeugt, dass es selbstverständlich nicht die eigenen Aggressionen und Motive sind, sondern allein die des anderen.
Erinnern wir uns: Aus Sicht der Objektbeziehungstheorie wird nicht nur das Selbstbild integriert, sondern, der gesamte Komplex: das Selbstbild, das Bild des anderen und der Affekt in der Mitte (wie ihn das Selbst und der andere jeweils erleben). Ich habe den anderen in mir, erkenne, wie sich die alte Freundin fühlt, die ich zufällig wieder treffe, aber auch, was den boshaften Nachbarn motiviert. Mit einigem, was man projiziert ist man selbst identifiziert. Man sieht, die Freundin ist irgendwie zerstreut, etwas anders, als man sie von früher kennt, fragt nach und in der Tat hört man von ihr, dass sie sich gerade Sorgen macht. Das ist einerseits ein Lesen der Körpersprache des anderen, andererseits Gegenübertragung: Wenn ich mich so verhalte, wie sie jetzt, bin ich zerstreut, also wird auch sie zerstreut sein. Ein Stück weit emotionales Mitschwingen durch unsere Spiegelneuronen ermöglicht, von unserem Bewusstsein erfassbar, einzuordnen und die Bestätigung zeigt, dass die Projektion – denn ihre Unruhe kann auch mich leicht nervös machen – stimmte. Hier allerdings ist es eine insofern unproblematische Projektion, weil man mit dem, was man projiziert selbst auch identifiziert ist. Klar, manchmal bin ich auch zerstreut, das kenne ich von mir, aber weniger von der Freundin, die sonst eher fokussiert ist, also frag‘ ich mal nach.
Objektbeziehunsgtheoretisch: Innerhalb des Spektrums der sich abwechselnden Affekte einer normalen Unterhaltung zwischen psychisch gut integrierten Menschen, rückt je nach Gesprächsinhalt mal das eine, mal das andere Thema und der dazu gehörende Affekt in den Vordergrund: Freude und herzliche Offenheit über das Wiedersehen, Neugierde über das, was in den letzten Jahren passiert ist, das Wiederaufflammen alter Gefühle der Verbundenheit und Sympathie oder die Feststellung einer emotionalen Distanz, die Trauer und das Mitgefühl über den Tod des Haustiers. Mit all diesen Emotionen ist man selbst identifiziert, man kennt sie auch von sich, wäre auch tief traurig, wenn die eigene Katze stirbt. Man kennt ebenso Zerstreutheit, aber auch Freude und Neugierde von sich selbst.
Bei Projektionen auf eher neurotischer Ebene ist man immer wieder von einem Thema besonders verfolgt, das man nun fast bei allen sieht, das einen erheblich irritiert bis empört und mit dem man selbst nicht identifiziert ist: „Das würde ich niemals machen, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man so drauf sein kann.“ Aber das Thema liegt einem näher als man glaubt. Bei projektiven Identifikationen fühlt man die Emotionen und den Atem des anderen im Nacken, weist aber eine Eigenbeteiligung empört von sich: „Ich? So? Nie! Der ist doch aggressiv, bösartig und stellt mir nach, was hab‘ ich damit zu tun?“
Die Pointe an dieser Stelle ist nicht, dem anderen einzureden, er sei doch selbst aggressiv und solle sich was schämen, sondern dieses Gefühl in sich zu erkennen und anzunehmen. Das ist besonders brisant bei sehr traumatischen oder chronisch aggressiven Erfahrungen. Wenn man über Jahre gequält, gedemütigt und unterdrückt wurde und keine Chance hatte an der Situation etwas zu ändern. Hier ist man Opfer und hat keine Wahl. Man ist identifiziert mit der Position des Opfers. Viele Opfer brauchen zunächst Unterstützung, Schutz, Zuspruch und jemanden, der verlässlich für sie da ist. Doch Heilung geschieht erst, wenn man lernt sich mit dem Täter in sich – jenem, der sich durch Leid und Qual in Form wiederholter Spitzenaffekte, zugefügt durch einen anderen, in die Psyche eingebrannt hat – zu identifizieren. Man weiß ja, wenn man gequält wurde, nur zu gut, mit welcher Lust an der Machtdemonstration ein Sadist einem immer wieder zeigt, dass man ihm ohnmächtig ausgeliefert ist.
Die große Ratlosigkeit, das große: „Wie kann man nur?“ bringt einen psychisch nicht weiter, weil es den anderen und sein Erleben nur auf Abstand hält und eigene Emotionen abspaltet. Der Andere ist dann das Monster, der ganz und gar Unverständliche. Wenn Rachephantasien aufkommen und man dem anderen, diesem Unmenschen, am liebsten – und sei es nur für eine kurze Zeit – auch mal gerne zufügen würde, was man erleiden musste, dann ist das psychologisch schon besser. Man kommt mit der eigenen Aggression in Kontakt, zunächst vermutlich noch zögerlich. Man meint es ja selbst eigentlich nicht böse, will dem anderen nur mal klar machen, was er da all die Jahre getan hat. Dieser Kontakt zur Aggression muss auf eine bestimmte Art intensiviert werden.
Und was hat das nun mit der Reinkarnationstherapie zu tun? Viel.
Täter und Opfer in der Reinkarnationstherapie
Der therapeutische Ausgangspunkt der Reinkarnationstherapie ist nach wenigen Sitzungen in leichter Trance – die gleichzeitig das Erleben von Bildern und die Kommunikation mit dem Therapeuten einüben (der Patient erzählt, was er da gerade sieht, fühlt und erlebt), sowie diagnostischen Wert haben – ein Gefühl, ein Affekt des Patienten. Irgendwo im Leben hakt es und der Patient ist an der Stelle entrüstet, hilflos, maßlos traurig, verzweifelt oder was auch immer. Der Reinkarnationstherapeut lässt sich diese Situation erzählen und verlässt dann mit dem Patienten zusammen das konkrete Geschehen und geht scheinbar weit weg. Aber emotional bleibt er am Ball. „Wie fühlen Sie Sich denn, wenn Ihr Mann, immer wenn man ihm widerspricht, seine schlimmen Herzstiche kriegt?“ Die Patientin fühlt sich vielleicht traurig, schuldig, ohnmächtig, wodurch jede Diskussion sofort unterbunden wird, schließlich will sie nicht, dass der andere ernsthaften Schaden nimmt. Was sie vielleicht nicht empfindet, ist Wut, schließlich ist der Mensch krank und da nimmt man Rücksicht, so hat man es gelernt.
Nach einigen wenigen Sitzungen kann man routiniert tun, was man inzwischen geübt hat, nämlich einfach in der Zeit zurückgehen, in eine Situation, die sich vielleicht symbolisch präsentiert, in der vielleicht Fragmente eines Kinofilms auftauchen, den man kennt oder die man sogar als authentisches früheres Leben empfindet, mit all den emotionalen Ausschlägen und Empfindungen, die man im normalen Leben auch hat. Wenn der Therapeut sagt: „Gut, bleiben Sie bei dem Gefühl und gehen Sie zurück in der Zeit, bis irgendein Bild, ein Gefühl, eine Situation auftaucht“, dann ist man recht schnell in dieser Bilderwelt. Dort erlebt man eine ähnliche Szene, wie die, mit dem eigenen Mann. Vielleicht ist man Angestellte im Dienst eines Landadeligen, der mit einem willkürlich macht, was er möchte, einfach weil er die Macht dazu hat. Man wird ungerecht behandelt, ist entrechtet und irgendwann wächst vielleicht aus der Trauer, die einen Nachts dazu bringt in die Kissen zu weinen, ein weiteres Gefühl. Vielleicht bekommt man hier das Gefühl von empfundenem Unrecht, Wut, dem Wunsch aufzubegehren besser zu greifen.
Genauso könnte aber auch der Mann mit den Herzstichen aufgrund derselben in die Therapie kommen. Was empfindet er? Auch er empfindet es als aggressiven Akt, dass er von anderen so provoziert wird, bis sich schwere körperliche Reaktionen einstellen und erst dann, wenn er in Lebensgefahr ist, lassen die Aggressoren von ihren bösartigen Forderungen ab. Auch dieser Mensch würde sich als Opfer fühlen. In der Bilderwelt könnte er ein Großgrundbesitzer sein, der sich aus seiner Sicht herzensgut um seine Angestellten kümmert und von lauter undankbaren Menschen umgeben ist, die gar nicht erkennen, wie kompliziert seine Position ist, wie wohlmeinend und engagiert er ist. So gut wie jeder erfährt sich zunächst als Opfer.
Die Geschichte ist immer ähnlich, sie lautet in etwa: „Wissen Sie, ich bin vielleicht nicht perfekt, aber im Kern ein herzensguter Mensch. Mit mir kann man auskommen, was ich nur nicht verstehe, ist, warum die anderen das nicht erkennen wollen und würdigen können. Ich weiß nicht, warum sich die Welt gegen mich verschworen hat, aber es scheint fast so.“ Das ist menschlich, das ist unsere privater Mythos, der uns selbst als netten, besonnenen und im Kern guten Menschen dastehen lässt, dessen einziges Problem es ist, dass er von undankbaren, verrückten und miesepetrigen Leuten umgeben ist, die ihm scheinbar das Leben zur Hölle manchen wollen. Ein an sich guter Mensch in einer bösen, schlechten oder durch und durch irrationalen und undankbaren Welt. Eine leichte Selbstüberschätzung mit der man an sich gut durchs Leben kommt, bis zu jenem Moment, wo das eben nicht mehr der Fall ist, weil andere nicht mehr mitspielen, weil das Selbstbild von anderen – die sich ja auch alle für an sich gute Menschen halten – nicht mehr ausreichend unterstützt wird. Dann beginnt man zu leiden, versteht die Welt nicht mehr und wenn das Leid groß genug ist, geht man zur Therapie.
In der Reinkarnationstherapie bekommt man zunächst, was man kennt. Man sieht und erlebt sich als Opfer. Nicht nur jetzt, sondern auch früher war es offenbar schon so. Man erlebt es ja in den Bildergeschichten, täglich, hautnah und intensiv. Doch nur für kurze Zeit. Denn auf der Ebene der Bilder kann man nun beliebig hin und her spulen, Situationen verlangsamen und genau anschauen oder eine größere Perspektive einnehmen und schneller vorspulen. Und wenn man ein paar Mal gelitten hat, gestorben ist, gefoltert wurde und dies sehr hautnah erlebt hat, dann kann man irgendwann auch an den Anfang eines solchen Lebens gehen und das ganze Bild betrachten. Wie kam es eigentlich dazu, dass ich jetzt am Galgen hänge und ersticke? Nun wird die Vorgeschichte betrachtet und irgendwann stößt man eventuell auf seinen eigenen Aggressionen. Die erscheinen aus der Situation heraus ganz natürlich. Man war ein Dieb weil man arm war oder in irgend einer Situation vielleicht ein Urmensch, der sich verteidigen muss und im wildem Kampf mit einer Keule jemandem mit aller Wucht und Wut den Schädel zertrümmert. Man lernt auf einmal die eigenen Aggressionen kennen, auch wenn es stellvertretend die eines behaarten und rohen Urmenschen sind.
Hier ist die nächste Stelle an der man wach sein und aufpassen muss. Wer denkt, es ginge darum nun erklärt zu bekommen, dass man die Suppe, die man sich in früheren Leben eingebrockt hat, eben auslöffeln muss und nun seine Strafe verdient hat und demütig akzeptieren sollte, der irrt. Psychotherapie geht nie so und funktioniert so auch nicht. Wäre das der Fall würde die Ansprache mit erhobenem Zeigefinger reichen, wir wissen aber, dass das nicht der Fall ist. Man kann Menschen zwar erfolgreich ins Gewissen reden, aber da muss der richtige Mensch zur rechten Zeit kommen und vieles zusammen passen. Es geht vielmehr darum, zum Beispiel die eigenen Aggressionen kennen zu lernen. Auch das nicht auf der vordergründigen Ebene konventioneller Gewohnheiten, mit der man diese gleich wieder wegschieben will: „Was bin ich nur für ein mieser Mensch, dass ich so aggressiv und durchtrieben bin, ist ja entsetzlich, das hätte ich ja nie von mir gedacht.“ Nein, darum geht es nicht und es würde die Ausgangslage der schon verdrängten Aggressionen nicht ändern, wenn man sich dafür verurteilt und versucht diesen „Makel“ nun möglichst schnell wieder los zu werden. Man ist ja schon in der Situation sich mit den Aggressionen (und anderen mehr oder weniger kollektiv unerwünschten Themen) nicht zu identifizieren. Aber es geht um Identifikation und Integration. Wer in die Bilderwelt verwickelt ist, sich kämpfend oder herrschend erlebt, der hat kein schlechtes Gefühl in dieser Situation. Sie passt zum Kontext. Wer voll selbstgerechter Wut überquillt, der fühlt sich stark, vital, im Recht und auf dem richtigen Weg sowieso. Wer andere mit einer Geste niederhalten oder über Leben und Tod entscheiden kann, fühlt in der Identifikation des Augenblicks den Kitzel und die Lust der Macht. Stärker, klüger, besser, mächtiger zu sein, fühlt sich gut an, ist ein Genuss.
Man lässt den anderen in diesem Gefühl der Lust, der prickelnden Vitalität baden, sich das Gefühl aus dieser anderen Welt genau beschreiben, so dass man merkt, dass er es genießt … und dann, plötzlich, sagt der Therapeut: „Gut, bleiben Sie bei dem Gefühl, das Sie genau jetzt haben. Kennen Sie das irgendwo her, aus Ihrem gegenwärtigen Leben?“ Und auf einmal erkennt man, dass die plötzlichen Herzstiche, die jede Diskussion und jeden Widerspruch im Keim ersticken, sich so ähnlich anfühlen und auch ein Machtmittel sind. Eines, was an die heutige Zeit angepasst ist. „Mir geht’s schlecht, lass mich in Ruhe. Wenn mir was Schlimmes passiert, ist es Deine Schuld.“ Früher hat man den Daumen gesenkt oder die Hand erhoben, die Machtmittel der Neuzeit sind oft Krankheitssymptome oder eingeforderte Rücksicht. Wer das in dieser Situation erkennt, weil er es erlebt, dem geht Licht auf. Das Opfer von einst, das urplötzlich Symptome bekommt ist auf einmal auch Akteur in einem Machtspiel und dort der Täter. Aggressiv drohend, nur eben nicht mit der geballten Faust, sondern mit dem Asthmaanfall, dem drohenden Infarkt oder den schrecklichen Schmerzen. Die früheren Leben, so sagt es Dethlefsen explizit, sind ein Weg um so präzise ins Hier und Jetzt zu kommen, wie man es sonst kaum kommt.
Denn würde man dem Patienten sofort raten: „Ja, dann sagen Sie doch einfach mal offen und klar, was Sie wollen“, kommt man in die Irrungen und Wirrungen der Beziehungen und muss hören, warum man mit dem/der Partner(in) einfach nicht reden kann, mit jedem, aber nicht mit ihr/ihm. Deshalb der Umweg.
Parallelen zur Objektbeziehungstheorie
In beiden Situation finden wir zunächst Menschen vor, die sich als Opfer empfinden und in der Opferrolle vorfinden. Das durchaus zurecht, denn wer als Kind ein jahrelanges Martyrium durchmachte, der hat sich das nicht ausgesucht. Wer Herzstiche, Asthmaanfälle oder den nächsten Schub einer chronischen Erkrankung erlebt, der leidet und ist zurecht verzweifelt. In beiden Fällen sieht und empfindet man sich als Opfer und das nicht einmal zu unrecht. Der Punkt ist nicht, jemandem einzureden, dass er kein Opfer ist. Das würde ohnehin nur noch mehr verwirren und wäre schroff gegen jedes Selbsterleben. Auch geht es nicht darum, jemandem, der nach menschlichem Ermessen tatsächlich unschuldiges Opfer ist, nun irgendwie die Schuld für sein Leiden in die Schuhe zu schieben. Das ist ein grobes und wie ich glaube, leider oft ideologisch instrumentalisiertes Missverständnis, auf das ich gleich noch gesondert eingehe, ich will es hier nur schon mal erwähnen.
Es geht darum, klar zu machen, dass irgendwo in den Tiefen der eigenen Psyche das Bild des Täters wohnt und wenn – gemäß der Objektbeziehungstheorie, weil immer, bei jeder Begegnung mit anderen, der ganze Komplex von Selbst, Anderem und dem, die Begegnung leitenden Affekt in der Mitte verinnerlicht wird; gemäß der Reinkarnationstherapie, weil jedes Erleiden seine erlebbare Vorgeschichte hat, die das einpolige Bild ausgleicht – man sich nur mit der Hälfte dessen identifiziert, was bereits in der eigenen Psyche zu finden ist, kann es nie zu einem Prozess der Heilung kommen, denn Heilung ist die Integration des Schattens.
Die Integration des Schattens
„Der Schatten, ist die Hölle, ist wirklich der Abgrund schlechthin.“ Sagt Dethlefsen. Und meint damit nicht Höllenqualen im Sinne weiterer Situationen, in denen man gequält und gemartert wird, sondern die wesentliche Einsicht ist die: Der Schatten ist nicht das eigene Leid, sondern die Situation, in der wir Täter sind. Es ist das schreckhafte, vielleicht schockhafte Erkennen, dass wir der Mensch sind, der wir nie sein wollten. Denn das steckt als persönliches Erleben hinter den etwas technischen Begriffen wie Projektion oder Schatten.
Im Grunde könnte alles ganz einfach sein: Du willst Deinen Schatten finden? Schau, wogegen Du etwas hast, was Dich stört und ärgert, das ist Dein Schatten. Fertig. So einfach geht’s, theoretisch. Praktisch ist das völlig unmöglich. Dethlefsen, ziemlich wörtlich: Es ist nicht schwer das Problem eines Patienten finden. Ein geübter Therapeut sieht das nach kurzer Zeit. Es es sehr schwer, Psychotherapie zu machen. Denn, wenn Sie einem Patienten in der ersten Stunde sagen, was sein größtes Problem ist, dann haben Sie a) Streit und b) den Patienten zum letzten Mal gesehen, weil er sagt: „Was, sowas sagen Sie mir? Also, von Ihnen als Therapeut hätte ich da mehr erwartet, so bin ja gerade nicht.“[5]
Das macht es so schwer. Die Psychotherapie arbeitet deshalb auch mit dem Element der Wiederholung. Man sieht die Zusammenhänge nicht einmal oder zweimal, sondern zigfach. Und wenn man nahezu jeden Tag, eine inhaltlich zwar andere, aber strukturell doch sehr ähnliche bis gleiche Geschichte erlebt, dann kann man sich irgendwann nur noch schwer gegen die Erkenntnis wehren, dass diese Geschichten, auch wenn man die Idee der Reinkarnation ablehnt, diese Erlebnisse etwas mit mir zu tun haben müssen, denn mindestens entspringen sie ja meiner Phantasie.
Und so ist die wichtigste Aufgabe des Therapeuten auch nicht den Schatten aufzudecken oder bewusst zu machen, obwohl das anspruchsvoll genug ist, sondern der wichtigste Punkt ist, dass man lernt, ihn anzugliedern. Integrieren heißt „Ja“ dazu zu sagen, heißt „ich“ dazu zu sagen. „Ja, so bin ich auch.“ Und da der Schatten genau das ist, was man seit Jahrzehnten vor anderen und vor allem vor sich selbst verstecken will, weil es genau der Bereich ist, den man überhaupt nicht leiden kann und bei anderen verachtet, ist dieser Schritt erstens, so schwer und zweitens, kann man sich nicht vorstellen, dass das – ausgerechnet das! – wirklich der eigene Schatten sein soll. Erkennt man ihn dann, ist man konsterniert, beschämt und muss „mal eben“ die gesamte Lebensgeschichte neu schreiben. Das macht es so hart, die Therapie so sensibel wie möglich zu gestalten und es ist vor allem so wichtig, dass der Therapeut sich in dem Bereich auskennt und ihn in sich selbst integriert hat, mindestens aber, dass er weiß und erlebt hat, was es praktisch bedeutet, mit dem eigenen Schatten konfrontiert zu sein und ohne Eigentherapie ist das mindestens sehr schwer bis unmöglich. Die Gefahr besteht darin, dass ein Patient, der seinen Schatten gefunden hat, den der Therapeut selbst nicht integriert hat, vom Therapeuten subtil entwertet wird, was die Ausgangslage noch verschlimmert. Die Integration ist das A und O.
Das natürlich auch und umso mehr bei Patienten, die den ungeheuer mutigen und psychisch anspruchsvollen Schritt gehen, den Schatten konfrontieren zu wollen und sich natürlich zunächst als jenes Opfer erleben, das sie juristisch und de facto sind. Ob man jahrelange Quälerei durch andere oder Todesängste durch Panikattacken erleiden musste, beides ist der pure Horror. Und weil es so schlimm ist, ist der Schritt so wichtig, zu wissen, dass es einen Ausweg gibt und das ist der beschriebene.
Es ist der Verzicht darauf sich nur noch und ausschließlich mit der Opferrolle zu identifizieren und das ist bei uns oft doppelt schwer weil man als Opfer unterstützt wird (was gut ist) und oft auch in die Opferrolle gepresst wird (was schlecht ist). Damit zu dem unerfreulichen Bereich wo Psychologie und Ideologie ineinander fließen, wir müssen ihn kurz streifen.
Die (bewusst) missverstandene Frage nach der Schuld
Es gibt eine ganze eigene Zunft, die davon lebt, die Menschheit vor der Regentschaft der Unvernunft zu retten. So jedenfalls sehen sich die wackeren Streiter, die sich gerne Skeptiker nennen und dem Glauben an die Vernunft verhaftet sind, zumeist selbst. Dass ihre robuste Zuversicht oft auf dem Fundament eines nicht eben breiten Wissens und Reflexionsvermögens steht, ist eine ironische Wendung, die gut zum Schattenthema passt. Wer sich bright fühlt, hat als Kontrast oft einen dunklen Schatten.
Doch die Überzahl der etwas Unbedarften ist nicht das wirkliche Problem, sondern die Fraktion von Ideologen, mit entsprechenden Motiven ist es. Hat man erst mal ein Feindbild, ist es auch egal, ob das was man dagegen in Stellung bringt auch nur im Ansatz gründlich recherchiert, richtig oder redlich ist, schließlich kämpft man für die gute Sache, wie es jeder Fundamentalist von sich annimmt. Seit Jahren steht, um nur ein Beispiel zu nennen, auf der Seite der politisch-ideologischen Skeptiker-Organisation GWUP über die Reinkarnationstherapie Dethlefsens zu lesen:
„In angeblicher „Fortentwicklung“ der Psychoanalyse, die die Ursache von psychischen Störungen in erster Linie in ungelösten Konflikten der frühen Kindheit sucht, geht die Reinkarnationstherapie in ihrer „Ursachenforschung“ weiter zurück. Noch vor der Empfängnis, also in angeblichen früheren Existenzformen, liege die Ursache von Störungen.“[6]
Wenn es tatsächlich zu viel verlangt ist, denjenigen, den man kritisiert überhaupt zu lesen, sind zumindest die Gründlichkeit und Redlichkeit kaum mehr mangelhaft zu nennen. An zahlreichen Stellen hätte man lesen können – dazu hätte man es freilich tun müssen – dass das in keiner Weise die Idee der Reinkarnationstherapie ist. Eine beliebige hier:
„Aus dem theoretischen Teil unseres Buches sollte bereits klargeworden sein, was Reinkarnationstherapie unter anderem nicht ist: Wir suchen nicht nach irgendwelchen Ursachen eines Symptoms in früheren Leben. Reinkarnationstherapie ist nicht eine zeitliche verlängerte Psychoanalyse oder Urschreitherapie.“[7]
Nach etwa einem Viertel Jahrhundert könnte man das wissen.
Auch Otto Kernberg ist zum Ziel von Kritik geworden, die nicht mehr auf die Thesen zielt sondern deutlich unangenehm gegen die Person gerichtet ist, ich lasse sie aus diesem Grunde unerwähnt. Dethlefsen Art provozierte eher zum Widerspruch, das wird ihm bewusst gewesen sein, damit hat er gespielt.
Wenn Dethlefsen und Dahlke zur Halbzeit vorne lagen, so gerieten sie, um in dieser Terminologie zu bleiben, doch sehr bald in Rückstand. Der Begriff Esoterik ist vollkommen diskreditiert, was einerseits nicht schlecht ist, da diese kein Breitensport sein kann, doch die Ideen leben noch und das Spiel ist noch nicht vorbei, der Anschlusstreffer erzielt.
Doch eine andere Kritik ist gehaltvoller. Es geht um den Vorwurf, dass einem Kranken oder einem Opfer durch die genannten Ansätze Schuld aufgebürdet würde. Die ideologisch motivierte Kritik nimmt was sie kriegen kann, um zu diskreditieren, doch einige Menschen, die sich ernsthaft und tatkräftig um Opfer und kranke Menschen kümmern sind hier ebenfalls irritiert.
Ich hoffe, dass aus dem bislang Dargestellten bereits ersichtlich wurde, worum es im Ansatz der beiden Varianten der zwei ungleichen Geschwister geht. Nicht darum, jemandem der leidet nun auch noch ein kühles: „Tja, selbst Schuld“ überzubraten, was sollte einen Therapeuten auch dazu motivieren? Im Gegenteil geht es darum, jemandem zu ermöglichen unbewusste und gut verborgene Bereiche des Schattens zu erkennen und anzugliedern, vor dem Hintergrund der Idee, dass eine viel umfassendere Heilung auf diese Weise möglich ist.
Integration bedeutet auf Kernbergs Seite, dass das Opfer die Lust des Täters nachempfinden können muss. Ein Opfer muss in gewisser Weise erlebend, in der Identifikation nachvollziehen, wie es dem Täter bei der Tat ging. Das ist aus drei Gründen nicht zu viel verlangt. Die auf dieser Theorie beruhende Therapie hat sich als sehr effektiv erwiesen. Zweitens, ist es das Bild des Täters, mit dem dazugehörigen Affekt aus Sicht der Täter: und der leidet ja nicht, wenn er jemanden sadistisch behandelt, sondern erfährt dies als lustvoll und hat sich ohnehin in die Psyche des Opfers über den Mechanismus der Spitzenaffekte tief eingebrannt. Der dritte und nicht unwichtigste Punkt: Ein Mensch, der chronisch Schreckliches erlebt hat, steht sehr in der Gefahr, das was er nicht integriert hat zu agieren, das heißt an die Umwelt im Wiederholungszwang weiter zu geben.
Dethlefsens Schuldbegriff ist nebenbei ein anderer, als der bei uns übliche. Er versuchte einen neuen (oder sehr alten) Schuldbegriff zu etablieren, wie man an zahllosen Stellen bei ihm erfährt. Er versteht Schuld nicht in dem bei uns üblichen Sinne, dass man schuldig ist, weil man etwas Bestimmtes gemacht hat, sondern konträr dazu ist Schuld für Dethlefsen das, was man nicht getan hat und der Einheit schuldet. Man sollte es demnach tun, damit man ganz oder heil wird. Konsequenterweise lastet Dethlefsen auch niemandem an etwas getan, sondern höchstens unterlassen, noch nicht getan zu haben. So kann in diesem psychologischen Sinne niemand dafür verantwortlich sein, was er getan hat, sondern höchstens für das, was er noch nicht getan hat. Das, so Dethlefsens Idee, kommt ihm dann als Repräsentant des nicht gelebten Prinzips aus der Umwelt, als Krankheit oder soziales Ereignis entgegen.
Doch analog zu Kernbergs Ansatz geht es auch bei Dethlefsen und Dahlke darum, die Täter in sich, man müsste treffender sagen, dass vom Täter ausgedrückte Prinzip in sich zu finden und zu integrieren, um heiler zu werden. Bei Dethlefsen und Dahlke mehr in einem metaphysischen Sinne, bei Kernberg eher auf einen psychologischen Bereich, der für eine integrierte Psyche steht, beschränkt.
Unterschiede zwischen Otto Kernberg und Thorwald Dethlefsen

Therapie ist immer auch ein Gang durch einsame und unbekannte Gefilde. © Sgt. Pepper57 under cc
Die offensichtlichsten Unterschiede hatten wir schon benannt. Kernberg, ein Mann der Wissenschaft durch und durch, der auf Studien und die Einhaltung wissenschaftlicher Standards pocht. Dethlefsen, der mit mit der Wissenschaft spätestens seit Schicksal als Chance, im Jahr 1979, in herzlicher und wechselseitiger Abneigung verbunden war.
Otto Kernberg ist ein überaus gründlicher Denker, nach eigenen Angaben ins leicht Zwanghafte hineinreichend, mit einem Breitbandwissen, das oft auch noch in die Tiefe ragt, ein großer Theoretiker und ein Mann der in der Therapie neue Bereiche erschlossen und Standards gesetzt hat. Ein zur Reflexion, Ironie und Selbstironie fähiger und liebenswürdig auftretender Mensch, soweit man das aus seinen Vorträgen schließen darf, der jedoch in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen hart ist.
Dethlefsen war ein Mensch, er verstarb 2010, der stets zu einer gewissen Maßlosigkeit neigte, ein Mann, der zwar ebenfalls gründlich arbeitete, aber der auch stark von Intuitionen geleitet war. Eine seiner Stärken war, Zusammenhänge präzise und bildhaft auf den Punkt zu bringen und mit einem Blick zu erkennen, ob an einer Sache etwas dran war oder nicht. Das brachte ihn dazu sehr viel theoretisches Wissen zu haben, aber engere Weggefährten sagten, dass er am normalen Leben im Grunde nicht teilgenommen hat, so dass er mancherlei Erfahrungen nicht machte, die auch dann wichtig sind, wenn sie sich als Irrtum erweisen. Dethlefsen war niemand der Widerspruch duldete und wohl eine eigenartig konventionelle Version von Unkonventionalität lebte. Legendär die Anekdote, dass er den Wehrdienst nicht verweigerte, sondern sich im Gegenteil freiwillig meldete, mit dem kleinen Zusatz, er wisse allerdings nicht, ob und inwieweit das seiner Aura schaden würde. Die Bundeswehr wollte ihn dann lieber doch nicht haben.
Sein Unterricht, in dem er selbst Reinkarnationstherapeuten ausbildete, beinhaltete Theorie am Vormittag, bei der er haarklein erklärte, was man tun und lassen sollte, danach eine praktische Vorstellung an einem Probanden, bei dem Dethlefsen in mindestens einem Fall dann so ziemlich alles anders machte, als er es eben noch erzählte, mit der abschließenden Bemerkung, es sei ja wohl offensichtlich gewesen, warum man hier anders vorgehen musste. Dies erzählte eine erfolgreiche Reinkarnationstherapeutin, die selbst bei Dethlefsen lernte und die ich fragte, wie er eigentlich als Therapeut war, die Antwort bestand aus nur einem Wort: „Genial.“ Kennt man Dethlefsens Vorträge und Meditationen mag man das glauben. Sein Ansatz war dann allerdings zu Beginn sehr intuitiv, er wurde dann aber später systematisiert. Es würde zu dem Mann passen, der stets auch Herausforderungen suchte und sein eigenes System zig mal kippte.
Ein wesentlicher Unterschied ist auch der weltanschauliche Überbau. Kernberg hält das Ideal der weltanschaulichen Neutralität hoch. Als privater Mensch, darf und soll man seine Meinung haben, als Therapeut „müssen wir erschreckend neutral sein“ (Kernberg). Gemeint ist hier die technische Neutralität, die sich nicht verwickeln oder verführen lässt den Patienten zu verurteilen (und in die Rolle des strafenden Vaters oder Über-Ichs zu fallen) oder sich mit ihm zu verbünden (und zum Kind oder Es zu werden), sondern eine Äquidistanz aufrecht hält. Ebenso Dethlefsen, der betont wie wichtig es ist, „ins Amt zu gehen“, wie er es nennt und damit dasselbe meint. Doch die Reinkarnationstherapie liefert noch einen speziellen weltanschaulichen Überbau mit. Kernberg, bei Licht betrachtet, auch, aber dieser Überbau ist der normale, wissenschaftliche, den wir gewohnt sind. Den Reinkarnationsgedanken sind wir nicht gewohnt und beinhaltet eine Sinn stiftende Funktion. Dieses Leben hier hat eine Vorgeschichte und ein Nachspiel. Das muss man in anderer Weise glauben, als den Naturalismus, den theoretischen Hintergrund des wissenschaftlichen Weltbildes, der zwar auch ein Glaubenskonstrukt ist, aber ein in unserer Kultur sehr verbreitetes, das deshalb als normal erscheint. Wir haben den Naturalismus mit der Muttermilch aufgesogen, das ist beim Reinkarnationsgedanken nicht der Fall.
Dieser Schritt ist ein optionales Angebot. Man kann die Reinkarnationstherapie problemlos durchlaufen, wenn man nicht an frühere Leben glaubt. Dann werden reale Leben zu imaginierten Bildern und da Psychotherapie ohnehin so gut wie immer mit Bildern, Phantasien, Projektionen und Vorstellungen arbeitet und die Frage, ob diese real sind zunächst eher nebensächlich ist, ist das im Grunde kein Problem. Erscheinen einem die Reinkarnationserlebnisse historisch echt, so öffnet sich ein weiteres Fenster, was therapeutisch über Sinnstiftung durch Weltanschauung wirksam ist, aber keine Therapie im engen Sinne dargestellt.
Weltanschauliche Unterschiede und ihre ethische Dimension
Anders als bei uns üblich kann man der Frage warum mir das, was mir passiert ist, passieren musste, in der Reinkarnationstherapie näher kommen. Das hat zum einen eine tröstende und Orientierung gebende Funktion, etwa, wenn ein Mensch mehrfaches und/oder außergewöhnliches Pech hatte. Wer mit der Idee der Reinkarnation etwas anfangen kann, kann Antworten finden, indem er sie in der Therapie erlebt. Das Problem ist, dass man dann als Exot gilt und über eine erhebliche Hürde muss, da das was wir in unserem Kulturkreis lernen, oft vollkommen anders ist. Doch oft ist es so, dass wenn durch Schicksalsschläge alles anders geworden ist oder eine schwere Krankheit den Blick auf das Leben radikal verändert, auch alte Glaubenssätze und Gewohnheiten ins Wanken geraten und hinterfragt werden.
Die Hauptkritik an dem Weltbild der Reinkarnation kann man auf drei Punkte reduzieren, die wir nur anreißen können:
- Die Reinkarnationsidee ist unbewiesen
Das stimmt nur zum Teil. Zum einen gibt es recht akribische Forschungen nach wissenschaftlichen Standards, bei der auch Kritiker anerkennen, dass hier gründlich und redlich gearbeitet wurde, gemeint ist vor allem die Arbeit von Ian Stevenson, der in diesem Kontext immer genannt wird. Genauer wäre es zu sagen, dass die Reinkarnationsidee nicht mit dem Naturalismus in Deckung zu bringen ist und das ist sie in der Tat nicht oder nur sehr schwer. Vor allem das klassische Dualismusproblem haben Menschen, die an Reinkarnation glauben, an den Hacken und die nötigen Antworten ins Irgendwie der Quantenwelten zu verlegen, ist nicht befriedigend.
- Die Reinkarnationsidee verlässt die weltanschauliche Neutralität
In gewissen Grenzen ist diese Kritik berechtigt. An Reinkarnation zu glauben ist ohne ein weltanschauliches Abweichen vom Gewohnten nicht zu haben. Jedoch wird dieser Glaube weder vorausgesetzt noch forciert und der therapeutisch entscheidende Punkt ist die Integration des Schattens, des bis dato Unbewussten. Diese hat oberste Priorität, wie erwähnt ist der Umweg über Erlebnisse, die sich als frühere Leben darstellen ein Kunstgriff, um ins Hier und Jetzt zu kommen und das eigene Leben und seine Geschichte besser, umfassender zu verstehen, gerade auch im Bezug auf klassische und kollektive Schattenthemen wie Aggression, Sexualität und Tod.
- Man sollte keinen Trost auf Unwahrheiten aufbauen
Man dürfe keinen Trost auf Unwahrheiten aufbauen, im Gegenteil sei man dazu verpflichtet taktvoll die Wahrheit zu vermitteln, sie verstehbar zu machen und dem Patienten zu ermöglichen, sie zu akzeptieren. Ein Punkt, der Therapie als Gegenpol zur Ideologie und Weltanschauung erscheinen lässt.
- Kurze Gegenrechnung
Diese Einwände sind alle gut und richtig, wenn man dabei nicht still voraussetzt, dass es bei unserem derzeitigen Weltbild alles zum Besten gestellt ist. Genau das wird aber unterstellt.
Der Naturalismus ist höchstens in einem zirkulären Sinne bewiesen. Man benutzt seine Ideen, weil man damit praktische Erfolge hat und genau das ist seine starke Seite. Gerade im Bereich der Psychologie und Psychosomatik gerät diese Art die Welt zu interpretieren aber bisweilen an ihre Grenzen, siehe zum Beispiel: Kritik am Naturalismus aus psychologischer Sicht. Eine Reduktion psychischen Geschehens auf die Sprache des Behaviorismus oder der Hirnprozesse ist bislang nie mehr als in Annäherungen gelungen.
Der zweite Punkt wurde bereits kommentiert, die Frage nach den Unwahrheiten und dem Trost ist ein wichtiger Aspekt. Bei schweren Schicksalsschlägen hat unsere Weltsicht wenig anzubieten, außer dem Hinweis auf das Pech, was man eben gehabt hat. Die Opfer sollen als Opfer geschützt, aber oft auch erhalten werden, selbst nicht esoterische Erklärungen, wie der Wiederholungszwang sind vielen suspekt, umso mehr, je mehr man dem Opfer den Mechanismus dieses Zwangs erklären und es therapieren könnte, etwas, was manchmal als Affront angesehen wird. In unserer Gesellschaft wird es zuweilen als sehr wichtig angesehen, dass niemand etwas dafür kann, dass ihm bestimmte Missgeschicke passieren. Der lange Schatten dieser Einstellung besteht allerdings darin, dass man dann eben auch selbst nichts ändern kann. Eine oft fatale Botschaft. Gerade Serienopfer oder chronisch kranke Menschen trifft es besonders hart, gerade sie bräuchten etwas, was ihnen hilft ihren Anteil an dem Geschehen zu verstehen. Genau dagegen wird besonders wütend argumentiert, in der schon beschriebenen Weise, dass hier einem Opfer noch zusätzlich Schuld aufgeladen würde.
In unserer Weltsicht wird die Opferrolle stark festgeschrieben und das oft wider besseres Wissen. Lassen wir den in unserer Kultur fremden Reinkarnationsgedanken mal ganz weg, schon Wiederholungszwang, primärer und sekundärer Krankheitsgewinn und die Frage der eigenen Erwartung, weisen alle in eine andere Richtung. Man kann nichts dazu, dass man in eine verheerende Situation gekommen ist. Das mag stimmen, aber manchmal hat man die Kraft bestimmte eingefahrene Muster zu durchbrechen und diese Chance sollte man leidenden Menschen nicht vorenthalten. Man ist gerade erst dabei das in einem breiten Sinne zu verstehen, nun muss die Theorie in Praxis übersetzt werden, aber eine achselzuckendes „Tja, ist halt Pech“ und im Wiederholungsfall die Botschaft, dass statistisch betrachtet manche eben viel Pech haben, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, umso mehr, als wir unsere Opfer, zwar gerne auf ihre unschuldige Rolle festlegen, sie aber dann nicht selten im Regen stehen lassen.
Und heute: Was mache ich damit?
Mich hat es stets fasziniert, so diametral unterschiedliche Ansätze wie die vorgestellten, oder anders: dass sie psychische Heilung aus der Sicht zweier ungleicher Geschwister so hohe Ähnlichkeiten ausweist, dass man kaum an Zufall glauben möchte. Es gäbe weitere Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die darzustellen hier zu weit führen würden. Kurz angerisssen:
Die psychoanalytischen Richtungen besprechen lieber konkrete Beziehungen und reale Beziehungen im Alltag, die Reinkarnationstherapie macht sie über den erwähnten Umweg bewusst. Allerdings greift man bei der übertragungsfokussierten Therapie (TFP), die Kernberg mit entwickelte, auch auf Metaphern zurück, um den Schatten zu spiegeln und dem Patienten immer wieder die Dynamik der gesamten Beziehung in einfachen Metaphern vor Augen zu führen. Auch das gleicht sich an.
Beiden gemeinsam ist ein Begriff der Heilung, der etwas meint, das größer als zuvor ist, nicht die Wiederherstellung eines vorherigen Zustandes. Wenn überhaupt, dann eines vorherigen im metaphysischen oder idealen Sinn. Doch es geht mir nicht allein um diese Kuriosität der Parallele, sondern auch und vor allem um einen Blick in die nahe Zukunft.
Inwieweit hat die psychische Heilung aus der Sicht zweier ungleicher Geschwister über den historischen oder vielleicht für einige Therapeuten interessanten Aspekt eine allgemeine Bedeutung? Inwieweit ist der erste Satz: „Es ist nun fast 50 Jahre her, dass in Deutschland ein sehr spezieller Funke zündete, der die psychische Heilung revolutionieren sollte“, überhaupt zu rechtfertigen? Die Reinkarnationstherapie gibt es nach wie vor, aber sie ist eine Nischentherapie und nicht wirklich anerkannt von den meisten Kollegen.
Doch die großen Grabenkämpfe sind aktuell vorbei, ein neuer Pragmatismus hat Einzug gehalten, nicht nur auf dem Gebiet der Psychotherapie, sondern auch in verwandten Disziplinen. Den Ansätzen ist gemeinsam, dass das in den letzten Jahrzehnten oft vernachlässigte Subjekt wieder stärker in den Fokus rückt und zwar in einer aktiveren Rolle. Der einzelne Patient ist nicht nur jemand, der einem Fachmann Auskunft über sich und seine Situation gibt, so dass dieser alles weitere übernimmt, sondern er wird aktiver eingebunden in den Prozess der Heilung. Sein individuelles Sosein und seine Sicht auf die Dinge werden stärker gefragt. In den letzten Jahrzehnten wurde versucht, objektive Parameter und Größen zu finden, doch ein objektiver Ansatz hat ganz wesentlich das subjektive Sosein des Patienten als starke Einflussgröße zu berücksichtigen, das ist das Ergebnis, die das Pendel zurückschwingen lässt.
Wo die Schere heute auseinander geht, ist in den Bereichen Wissenschaftlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Verfahren müssen möglichst schnell und effizient sein, doch einige Bereiche haben sich hier als notorisch sperrig erwiesen. Nicht zuletzt die Psyche (der meisten Menschen) selbst, die sehr anpassungsfähig ist und den dahinter liegenden Optimierungsgedanken der Gegenwart bereits verinnerlicht hat. Doch nicht selten geht der Schuss nach hinten los: Perfektionismus und Narzissmus, Burnout und Depressionen scheinen Folgen dieser Entwicklungen zu sein. Doch auch auf den ersten Blick organische Leiden stellen sich ein: Rückenschmerzen, oft chronische, Immunerkrankungen und endokrinologische Erkrankungen.
Der wirtschaftlicher Druck ist allgemein problematisch, in der Medizin besonders, er führt zu zwei konträren Bewegungen. Zum einen sind kostengünstige und schnelle Verfahren beliebt, aber nicht immer sind sie die besten. Es besteht die Tendenz, dass Patienten oft kostengünstige, aber weniger als optimalen Therapien und Behandlungen erhalten. Konträr dazu fordern und bekommen finanzstarke Patienten oft eine privilegierte Behandlung, die sich zunächst jedoch oft auf den Komfort bezieht. Doch da auf dem Komfortsektor die großen Kliniken schon alle nachgezogen haben, ist der der nächste Punkt wirkliche Spitzenmedizin, die sich nicht nur auf den operativen Bereich bezieht. Weniger und individualisierter ist hier oft mehr und Spitzenmedizin heißt eben auch auf den konservativen (medikamentösen), psychologischen und psychosomatischen Bereich, nicht zu vergessen die Arbeit von Ergo- und Physiotherapie, sowie der Krankenpflege in ein Gesamtkonzept einzubinden und stärker auf ihn zu setzen. Aktuell bringen aber vor allem Operationen Geld.
Die Forschung in der Spitzenmedizin ist gerade dabei die Rolle des Subjekts und seiner Einstellungen (nicht nur seiner körperlichen Parameter) zu erkennen, wie in der Placebo- und Noceboforschung und zahlreichen anderen Bereichen. Der zündende Funke ist auch in der Reinkarnationstherapie nicht etwa die Reinkarnation (ob es die tatsächlich gibt oder nicht hat auf die Therapie erst einmal keine Auswirkung), sondern die zentrale Rolle des Subjekts, seiner Einstellungen und Werte, auch den tiefer liegenden, die das Muster, das Sosein eines Menschen ausmachen. Die Rolle einer Verantwortung für das eigene Leben sind in vielen Bereichen der Psychotherapie selbstverständlich, in der Medizin oft noch nicht. Zwar wird eine schlechte Compliance hier auch kritisch gesehen, aber man weiß nicht recht, was man in so einem Fall tun soll, außer festzustellen, dass die Kooperation eben nicht gut ist und dem Patienten eventuell ins Gewissen zu reden. Die Psychosomatik ist hier ein Bindeglied und es macht durchaus Sinn, in einem erweiterten Sinne zu unterstellen, dass jede Krankheit auch einen psychischen Anteil hat und dann pragmatisch abzuwägen, ob man ihn näher betrachten sollte. In einigen Fällen lohnt es sich.
Über die Rolle der Phantasie und Imagination haben wir berichtet, über Analogien wäre zu berichten, da sie ein Herzstück des psychosomatischen Ansatzes von Dethlefsen und Dahlke darstellen. Unsere Denkweise benutzt zwar Analogien in Hülle und Fülle, unsere Alltagsprache ist psychosomatisch und viele Erkentnnisse der Wissenschaft sind vor allem der Fähigkeit zu analogem Denken entsprungen, man kann mit explizitem analogem Denken aber wenig anfangen. Ihr Revival, sogar als „Herz des Denkens“, erlebte die Analogie in dem Buch von Douglas Hofstadter & Emmanuel Sander, zu dem ich mindestens auf diese Rezension verweise.
Herausforderungen
Diese Ansätze sind aktuell dabei überall durchzudrücken und haben den Vorteil theoretisch zwar manchmal anspruchsvoll zu sein, doch in der praktischen Anwendung einfach. Es ist wie mit Elektrogeräten unseres Alltags, deren technische Seite nur noch Experten verstehen, die jedoch fast jeder Laie bedienen kann.
In der Praxis ist es weder schwer noch teuer etliche der Neuerungen zu integrieren. So laufen viele Praktiken der Placeboforschung auf eine sprechende Medizin hinaus, in der auf die Wortwahl geachtet wird, auch auf eine für den Patienten oft nützliche Reduktion von Medikamenten. Sprechen ist auch wichtig, um den Patienten mit chronischen Erkrankungen besser kennenzulernen, nicht nur seine bisherigen Therapien und welche Medikamente er nimmt, sondern welche Einstellungen und welches Weltbild er hat.
Es ist wichtig die Rollen der Psyche stärker zu beachten, aber sich auch hier nicht zu sehr darauf zu fixieren. Ein Patient mit 50 kg Übergewicht profitiert bestimmt davon, wenn er weiß, wofür die Esserei möglicherweise ein Ersatz ist, aber dennoch wird er abnehmen und Diät halten müssen, wenn er gesünder werden will.
Dass der Patient mehr Beachtung findet heißt im Umkehrschluss, dass er auch mehr Verantwortung übernehmen muss und darf. Das „darf“ ist wichtig, denn es handelt sich nicht um eine Drohung, sondern eine Chance. Verantwortung bedeutet Verpflichtung, aber auch Mitspracherecht. Spitzenmedizin einzufordern heißt nicht teure, sondern nachhaltige Medizin einzufordern. Überall. Beim Arzt, den Krankenkassen, der Politik. Und einfach dorthin zu gehen, wo dies beherzigt wird.
Wir werden weiter über diese Entwicklung berichten und praktische Beispiele herausgreifen und vorstellen.
Quellen (und Bildrechte):
- [1] Angelika Koller, Thorwald Dethlefsen die Reinkarnationstherapie und Kawwana: Ein Beitrag zur Psychotherapie- und Religionsgeschichte, Books on Demad Gmbh, Norderstedt, 2004, S.43f
- [2] Edith Zundel, Die ordnende Kraft – Otto F. Kernberg: Wegweiser im Dickicht der Psychoanalyse, Die Zeit vom 21. November 1986, 7:00 Uhr, online unter: http://www.zeit.de/1986/48/die-ordnende-kraft
- [3] Edith Zundel, Die ordnende Kraft – Otto F. Kernberg: Wegweiser im Dickicht der Psychoanalyse, Die Zeit vom 21. November 1986, 7:00 Uhr, online unter: http://www.zeit.de/1986/48/die-ordnende-kraft/seite-2
- [4] Thorwald Detlefsen, Reinkarnationstherapie, Hermetische Truhe
- [5] nahezu so zu hören auf: Thorwald Detlefsen, Reinkarnationstherapie, Hermetische Truhe
- [6] https://www.gwup.org/infos/themen/65-religion-glaube/73-reinkarnation
- [7] Thorwald Dethlefsen und Rüdiger Dahlke, Krankheit als Weg, Bertelsmann 1983, S. 355
Einzelnachweise zum Titelbild und ersten Artikelbild:
- Linkes Foto: Fotograph: Reading Tom; Abbildung: New York Hospital -Cornell Medical Center online: https://www.flickr.com/photos/16801915@N06/8190420741 ; Nutzungsrecht: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- Rechtes Foto: Von Wolfgang Rieger – Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2068469