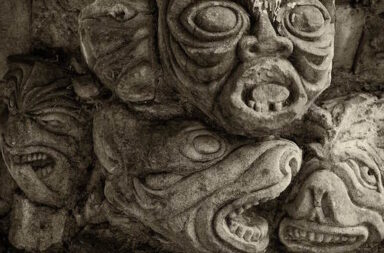Entspannend, gesund, gesellig, naturnah: der Waldspaziergang, den man zu jeder Jahreszeit mit vielen Sinnen genießen kann. © Falk Lademann under cc
Veränderungen sind dem Menschen oft unangenehm. Davon künden Sprichwörter wie: „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, mit dem metaphorischen Baum ist hier auch der Mensch gemeint, oder noch direkter: „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“. Wir wollen einen einmal eingeschlagenen Pfad oft nicht wieder verlassen und tatsächlich rufen Veränderungen aller Art beim Menschen Stress hervor, auch positive Veränderungen.
Doch auf der anderen Seite erkennt man auch mehr und mehr, dass es trotz der generellen Abneigung individuell starke Unterschiede gibt. Neugier, Offenheit für neue Eindrücke und Optimismus kennzeichnen viele intelligente, kreative und glückliche Menschen, die auch mit Freuden gewisse Wagnisse eingehen. Andererseits sind depressive, ängstliche und pessimistische Menschen, oder jene, die etwas zu verlieren haben, eher konservativ eingestellt und scheuen Veränderungen.
Zudem ist dies auch eine Frage des Alters, für Kinder und junge Menschen ist das Leben noch voller Überraschungen und Verlockungen, irgendwann hat man vieles gesehen, es sich im Leben eingerichtet, im besten Fall gefunden, wie man selbst leben möchte und irgendwann dann vermutlich einfach keine Lust mehr, sich wieder in etwas ganz Neues einzuarbeiten.
Ist unsere Zeit besonders?
Veränderungen hat es zu allen Zeiten gegeben, inklusive der Vorstellung, die Zeit, in der man lebt, sei eine besondere und der Phantasie, dass das Ende nahe sei. Oft wurde der Weltuntergang schon ausgerufen, zuletzt 2012. Das 20. Jahrhundert ist vollgestopft mit diversen Brüchen und Veränderungen, in Technik, Physik, Medizin, Psychologie; zwei Weltkriege, Aufstieg und Fall des Kommunismus, elektronische Massenmedien, die 68er Revolution, die Mondlandung und das Internet, um nur einige zu nennen.
Nun stehen weitere Veränderungen an, darunter einige die als ungeheuer bedeutend angesehen werden, wie der Klimawandel, Überbevölkerung, Migrationsströme, das Müllproblem, Wasser-, Rohstoff- und Ressourcenmangel, Gentechnik, Robotik und künstliche Intelligenz in Medizin, Arbeit und Überwachung, aber auch gesellschaftliche Veränderungen, wie die Bewertung von Ethnien, Klassen, den Geschlechterrollen, der sexuellen Orientierung und dem Unterschied zwischen Mensch und Tier. Vor allem scheinen die Wechsel in immer kürzen Abständen zu geschehen. Alles in allem ist das viel, vielleicht überfordernd viel.
Wenn man mit dem konfrontiert ist, was andere notwendig finden, man selbst aber nicht, so kann das mehrere Gründe haben:
- Man versteht es intellektuell nicht
Angesichts der Komplexität des Zusammenspiels der vielen Bereiche, ist es nachvollziehbar, wenn vielen Menschen die Zusammenhänge zu kompliziert sind.
- Man lässt etwas emotional und unbewusst nicht an sich heran
Es gibt genügend Beispiele dafür, dass es Verdrängungsmechanismen gibt, die beim einzelnen Menschen sehr ähnlich funktionieren, wie bei einer Gemeinschaft, auch einer wissenschaftlichen: Zunächst werden abweichende Daten komplett ignoriert, dann kleingeredet und erst wenn sie sich nicht mehr leugnen lassen, beschäftigt man sich mit ihnen.
- Man versteht es, sieht sich aber nicht als Adressaten
Es kann durchaus sein, dass jemand über bestimmte schlechte Eigenschaften doziert oder diese wirklich entsetzlich findet, aber tief überzeugt ist, dass er davon überhaupt nicht betroffen ist. Das Umfeld kann da durchaus anderer Meinung sein.
- Man versteht es, findet den Anreiz aber nicht hinreichend
Wenn man versteht, worum es geht und dass man selbst angesprochen ist, der zu erwartende Lohn einer Veränderung oder die zu erwartende Angst jeweils nicht groß genug sind, wird man ebenfalls nicht motiviert sein, sein Verhalten zu ändern.
- Man setzt andere Prioritäten
Es kann sein, dass jemand durchaus versteht, dass er aus einer bestimmten Sicht betrachtet, sein Verhalten ändern müsste, aber andere Prämissen hat oder Prioritäten setzt. Das muss man dem anderen zugestehen, eventuell sind seine Argumente sogar gut und überzeugend oder für ihn eben passend.
- Man ist anderer Meinung
Das kann man natürlich immer sein, eine der wesentlichen Fragen ist, ob und wie man seine Meinung begründen kann, jedoch muss man anerkennen, dass auch wenn jemand intuitiv nicht überzeugt ist, er eben nicht überzeugt ist. Auch hier wäre es wichtig, ins Gespräch zu kommen, nicht um den anderen zu überreden, sondern seine Argumente ernsthaft zu prüfen oder sie mit ihm zu entwickeln.
Entscheidungen
Trifft man wirklich Entscheidungen und zieht diese auch durch, so dass sie zu realen Veränderungen führen, dann ist das bei wichtigen Dingen nie allein ein rationales Spiel. Erstaunlicherweise haben sich Theorien, die im Menschen einen rationalen Agenten, einen Computer mit Ohren sehen, sehr lange Konjunktur gehabt, etwa bis zum Beginn der Hirnforschung, wo plötzlich und unerwartet und ebenfalls erstaunlich einseitig die These aufgestellt wurde, es seien die Emotionen, die entscheiden, was nun tatsächlich gemacht wird, eine für Wissenschaftler gewagte These, die ihren gesamten Berufsstand, der auf rationale Begründungen zugeschnitten ist, überflüssig macht.
Wie auch immer, die Wahrheit scheint schlicht zu sein, dass beide Komponenten eine Rolle spielen. Wir sind durchaus in der Lage vernünftige Argumente einzusehen, doch die Macht der Gewohnheit, eine gewisse Bequemlichkeit, Trotz, Rechthaberei oder dergleichen können all dem einen Strich durch die Rechnung machen. Rationale Erwägungen, wie die, wie groß die Aussicht auf einen Gewinn ist, wenn man etwas tut, spielen durchaus eine Rolle. Also soziale Anerkennung, Statuserhöhung, mehr Geld oder sonstige Vorzüge, aber ebenfalls die Aussicht auf eigene Betroffenheit? Passiert mir was, wenn ich es nicht tue? Nicht nur körperlich oder finanziell, sondern habe ich Verluste im Ansehen. Das berühmte: „Was sollen denn die Nachbarn sagen?“ hat durchaus Relevanz, nur eben keine rein rationale, sondern eine emotionale. Man will zudem im Grunde kein schlechter Mensch sein, nur den wenigsten ist es vollkommen egal, was andere von ihnen denken (darunter Psychopathen und Exzentriker), den meisten Menschen sind Ansehen und Ruf sogar äußerst wichtig, spätestens dann, wenn es um die Menschen geht, die einem selbst auch wichtig sind.
Gleichzeitig und ebenfalls eher emotional kann auch eine Angst vorliegen zu verlieren, was man hat. Verständlich, da hat man sich vielleicht über Jahre bis Jahrzehnte mit Fleiß und Entbehrungen etwas aufgebaut und nun soll man es nicht genießen können. Das löst Angst und Ärger aus, alles Gefühle, die Menschen konservativ werden lassen, auch solche, die tendenziell, von ihrem Naturell her, eher offen sind. Diese Angst muss man ernst nehmen und diese Menschen nicht noch als Spießer diskreditieren. Wenn Entscheidungen, die zu Veränderungen führen rational und emotional sind, muss man beide Aspekte bedienen, wenn man Veränderungen will.
Das Spiel ist aus

Lebenswerte Plätze und Orte der Begegnung zu schaffen, muss gerade für die Zukunft ein Ziel sein. © Pixelteufel under cc
Manche sprachen schon vor Jahren vom Ende der Spaßgesellschaft und meinte damit eine tendenziell uninteressierte Gesellschaft, die Partys macht und sich ansonsten um wenig schert und vor allem das eigene Wohlergehen im Sinn hat. Auch das gibt es noch, aber wenn irgendwer aufgewacht ist und es ernst meint, dann die oft geschmähte Jugend, die von immer mehr Menschen, darunter auch den Wissenschaftlern unterstützt wird.
Die Spielereien findet man daher eher auf Seiten der Politik und Wirtschaft, die ihre Macht und Geschäfte nicht einbüßen wollen, ein verständlicher Wunsch, aber kein gerechtfertigter. „Och menno, es lief doch so gut“, ist so wenig ein Dauerargument, wie der Verweis auf Arbeitsplätze, die gesichert sein wollen. Aber auch Privatbürger können in Zukunft nicht weiterleben wie bisher. Schlimmer noch, viele müssen die Träume ihres Lebens vielleicht begraben vor allem, wenn diese um viel Besitz kreisen und zwar, weil gleich mehrere parallele Veränderungen anstehen.
Effizienz und Suffizienz
Was man den Grünen vorwirft, ist, die Illusion zu nähren, dass es mit mehr Effizienz im Grunde weiter so gehen könnte, wie bisher, wenn nur die richtigen Techniken eingesetzt werden, wenn wir konsequent auf Ökostrom setzen und dergleichen. Doch das scheint nicht zu reichen und dabei sind wir nur bei einem, der derzeit prominenten Thema, dem Klima. Schon hier reicht mehr Effizienz jedoch nicht, sie ist gut, doch Suffizienz, Einschränkung und Verzicht sind besser. Verzicht, vor allem, wenn er verordnet ist, ist jedoch ein Reizwort und das aus gutem Grund.
Es ist einigermaßen verstörend, wenn man sieht, wie viele Menschen ihre Begeisterung für gesetzliche Verbote, Zwangsmaßnahmen, bis hin zu einer Ökodiktatur kaum zurück halten können. Fast, als hätten sie darauf gewartet. Nur sind Diktaturen stets die fiesesten Bedingungen, unter denen man leben kann, also lohnt sich der Blick auf bessere Alternativen. Alternativen, bei denen man zwar einerseits vielleicht verzichtet, aber andererseits gewinnt und zwar mehr gewinnt und etwas, was man selbst als wertvoll empfindet. Denn wir wollen ja das Überleben sichern und den Wohlstand vergrößern und müssen schrittweise lernen, dass das keine Mogelpackung ist, weil man entweder nur das eine oder das andere haben kann, sondern es tatsächlich möglich ist, auch vielen Ebenen gleichzeitig zu gewinnen.
Wie aus Verzicht ein Gewinn wird
Ist das nicht eine von Anfang an verlogene Story? Ist Verzicht nicht immer schlimm und kann man sich das nicht allenfalls schön reden?
Nein. Nehmen wir Beispiele die lebensnah sind. Wenn es Menschen mit schwerem Übergewicht gelingt ihre überflüssigen Kilos loszuwerden, dann verlieren sie auch etwas, dann müssen sie auch mit etlichen Gewohnheiten brechen, aber viele von denen, die es durchgehalten haben, gestehen nachher, dass ihr Leben viel besser geworden ist. Die Tendenz sich etwas vorzumachen liegt eher im Vorfeld, wenn man sich einreden muss, dass man sich mit 180 kg noch so richtig wohl, gesund und sexy findet.
Es gibt die Menschen, die versucht haben den Selbstoptimierungstrip der letzten Jahre mitzumachen und dabei feststellten, dass sie es einfach nicht schaffen. Wenn man sich das ehrlich eingesteht, ist das kränkend, aber bald danach merkten viele dieser Menschen etwas anderes: Nämlich, dass ihre Lebensqualität und Zufriedenheit seit ihrem Ausstieg erheblich gewachsen ist. Sie fühlen sich nicht als Verlierer, sondern als Gewinner, weil Berge von Stress und fragwürdige Ziele mit einem Mal von ihnen abgefallen sind.
Wenn wir uns zwei häufige Krankheitsbilder unserer Zeit anschauen, nämlich Depressionen und Schmerzen, so wird es ebenfalls niemand als Verlust empfinden, wenn man diese verliert und mehr noch, durch eine Wendung des Blicks wird heute immer mehr klar, wie beide zusammenhängen und dass man selbst viel tun kann. Bei der Depression ist das schwer, weil Antriebsarmut und Resignation zum Krankheitsbild gehören, aber am Anfang kann man sich helfen lassen und vieles lässt sich sehr gut regeln, wenn man natürliche Lebensrhythmen beachtet. Einer der Kernpunkte dabei ist Bewegung, die Schmerzen nimmt, glücklich macht, obendrein hilft Gewicht zu reduzieren, fitter zu werden und dann wieder echte Freude an der Bewegung zu empfinden.
Jedoch hat man gerade auch aus der Erfahrung mit chronischen Krankheiten gelernt. Denn, wenn es gelingt, diese zu heilen, ist natürlich zum einen die Freude groß, zum anderen fällt man unter Umständen gleich danach in ein tiefes Loch, denn wenn sich die letzten Jahrzehnte des Lebens überwiegend um eine Krankheit gedreht haben und diese der zentrale Inhalt des Lebens war, so fällt damit eben auch der Lebensinhalt weg. Soll heißen, selbst wenn Unangenehmes wegfällt, entsteht ein psychisches Loch und auch das muss man auf dem Schirm haben und etwas dagegen tun – das kann man aber.
Ehrlich werden
Der Mensch ist nicht nur ein rationales und emotionales Wesen in unterschiedlichen Teilen, bei unterschiedlichen Themen, auch ein anderes Thema der letzten Jahre ist ähnlich merkwürdig diskutiert worden. Viele bemühen sich zu betonen, der Mensch sei im Kern ein Egoist und führen dafür die unterschiedlichsten Begründungen an. Seine Gene, sein rational berechnendes Wesen, den Drill durch den Kapitalismus. Dabei sind gerade Menschen, wie andere Forscher zeigen, überaus kooperativ, auch wenn sie davon nicht profitieren. Doch in aller Regel finden wir den Menschen in den meisten Fällen irgendwo in der Mitte angesiedelt, manchmal hilft man aus Berechnung, manchmal einfach gerne, manchmal freut man sich, wenn man eine Anerkennung dafür bekommt und oft sind die Motive bunt gemischt.
Da wir Menschen aber auch egozentrische Züge haben und diese oft dominieren, wenn wir Angst haben, sollte man diese ängstliche Seite des Menschen auch ansprechen und egozentrisch argumentieren, im Sinne von: Was habe ich für einen Gewinn davon, wenn ich das mache? Der Vorteil dabei ist, dass, selbst wenn man aus den falschen Gründen beginnt das Richtige zu tun, dies dennoch einen positiven Effekt haben kann. Umgekehrt erst mit der großen Charakterveränderung oder dem Bekenntnis zu beginnen, sorgt eher für Widerstand.
Die Angst der Menschen ist nicht unbegründet und oft ähnlich. Man hat Angst vor Krankheiten, Krebs, Schmerzen und Demenz, vor Armut und Einsamkeit und auch das Gefühl der Unsicherheit spielt eine Rolle. Auch das Ansehen zu verlieren bleibt bis ins hohe Alter ein Aspekt. Immer klarer wird in den letzten Jahren, wie fundamental Beziehungen für uns sind. Schon in einem klassischen Experiment an Affen wurde von einem jungen Affen eine Mutterattrappe der Nahrung vorgezogen. Doch auch in der Gegenwart sehen wir, an den Smartphones, wie wichtig für uns Kontakt ist, so dass der Statusverlust oder gar die Ächtung in Form des Kontaktabbruchs schlimme Strafen sind.
Aufwärtsspiralen oder Synergieeffekte

Die Blumenwiese ist für Insekten und die Seele gleichermaßen gut. © Daniel Jolivet under cc
Nimmt man all das zusammen, hat man ein Bündel an Zutaten, mit deren Hilfe man die anstehenden Veränderungen anstoßen kann. Dabei geht es weniger um fertige Rezepte, als viel mehr um Strategien die individuell und der jeweiligen Situation angepasst sind. Das eine Rezept für alle ist immer etwas unterkomplex, wichtiger ist, dass diejenigen, die wirklich etwas begriffen haben ihre eigenen Stärken kennen und so selbst den Ort finden, an dem sie angesichts der Fülle und Komplexität am besten helfen können.
Die Beispiele, die wir bislang aufführten, betrafen Menschen in Not, denen es schlecht geht, aber es gilt auch diejenigen anzusprechen, denen es ganz gut geht. Auch die haben in den meisten Fällen keine Lust die Welt vor die Hunde gehen lassen, egal ob sie Nachkommen haben, oder nicht. Es bringt wenig große Arien der Selbstverdammung zu singen oder wiederholt zu erklären, dass ohnehin alles zu spät sei.
Die Aufforderung sich auf die eigenen Stärken zu besinnen klingt zwar nach einem billigen Motivationsseminar, aber wir Menschen sind in der Lage die Dinge zusammen zu denken, besser als jeder aktuelle Supercomputer. Wir erinnern uns, es geht ungefähr um zehn dickere Aufgaben, die parallel angegangen werden müssen und da gibt es nicht den einen richtigen Ansatz, sondern einen Zusammenklang mehrerer Ansätze, die man koordinieren muss. Aber nicht einer, sondern viele. Dabei sieht jeder vermutlich den einen Aspekt als ein wenig bedeutsamer an, als einen anderen, aber gerade wenn viele normale Bürger verstehen, dass es etwa zehn annähernd gleich wichtige Themen gibt, können sie das Gesamtpaket immer wieder neu koordinieren. Die Macht unserer Meinungsäußerungen ist – etwa durch die diversen Kanäle des Internet – stark wie nie, diejenigen, die sie bereits nutzen, haben das längst erkannt.
Es gilt das ganze Sammelsurium neu zu ordnen und nicht den Blick nur auf das Detail oder einen Aspekt zu lenken. Entspannt sein und das Ganze erkennen. Eine vollwertige, vitalstoffreiche Ernährung ist für den einzelnen gesund und gleichzeitig gut fürs Klima. Wer prasst, will was erleben, besser geht das allerdings durch Veredelung, durch das Erleben von Vielfalt, statt nur von dem wenigen, was man hat, immer mehr zu konsumieren.
Aber jeder hat sein Feld auf dem er eher Neues erfahren und experimentieren will und ein anderes, auf dem er eher konservativ ist. Ob Essen und Trinken, Opern oder E-Gitarre, Sexualität oder Online-Gaming, die Erforschung der Sprache, Sport oder das Zusammensein mit Haustieren, Spiritualität oder Philosophie, künstliche Intelligenz oder Gartenarbeit, Heimwerkern oder Sammeln, die Welt ist bunt.
Glück, Gesundheit, soziale Verantwortung und Sinn
Glücklich sein wollen alle, statistisch hat Glück bei Umfragen vor allem mit Gesundheit zu tun, bei den Erkenntnissen der Forscher primär mit Beziehungen. Lieber wenige tiefe, verlässliche Beziehungen, als viele oberflächliche. Das brauchen wir von Anfang an. Glück bedeutet zudem für anderen da zu sein und zwar persönliches Glück. Sich einzuschließen, zurückzuziehen und alles was man noch hat krampfhaft zu verteidigen, ist ein sicherer Weg ins Unglück, gerade wenn man egozentrisch argumentiert und sich zuerst sieht.
Die recht einfache Lösung ist, dass es mir gut geht, wenn ich Anerkennung erfahre und das heißt, für andere da bin, gerade auch, wenn es mal Opfer bedeutet. Einander zu helfen, kann in den nächsten Jahren ein zentraler Wert werden, für einander da zu sein, vielleicht kann der eine gut kochen, der andere reparieren, der dritte kann gut zuhören und verfügt über soziale Kompetenzen.
Wir können neue Formen des Wohnens und des Miteinanders etablieren, es ist nicht einzusehen, warum immer mehr alte Menschen in traurigen Heimen entmündigt werden sollen, Alt-/Jung-Gemeinschaften könnten eine Lösung sein, mit Musikabenden, Internetanschluss, Meditationsgruppe und Rotwein, gesundem und leckeren Essen.
Wenn wir es schaffen, einen neuen Mythos zu etablieren, der um das Thema der Bewahrung der Natur, der Schöpfung, von Gaia kreisen könnte, der größeren Teilen der Bevölkerung Sinn und Richtung gibt, haben wir neue soziale Rollen für jeden, jeder kann, so wie er oder sie es schafft seinen Teil beitragen. Aber Umweltschutz klappt nur mit Wohlstand für alle und Wohlstand heißt nicht unendlicher Konsum, sondern, dass es einen gut geht, möglichst besser, als vorher. Das geht über Kontakt, Anerkennung, in dem Maße, wie man es individuell braucht. Man könnte gemeinsame Rituale einführen, die die Menschen verbinden und ein Element darstellen, mit dem man Lebensphasen begleiten kann.
Weniger Struktur als bislang ist kaum möglich und die Angebote an Rollen und Orientierung bis hin zu neuen Erzählungen sind nicht immer die besten. Dass das Ich und das Wir zu stärken kein Gegensatz ist, wäre ein nächster Schritt, den man begreifen könnte, die allzu technischen und funktionalen Es-Erzählungen, die alle Welt auf Nutzen und Funktion reduzieren kann man etwas herunter dimmen. Wenn man erkennt, dass es auf Großorganisationen ebenso ankommt, wie auf den Einzelnen, kann man aufhören, die Verantwortung immer von A nach B zu schieben, sondern seinen Teil beitragen, der Umwelt zuliebe, der Gesellschaft zuliebe und auch sich selbst zuliebe. Die Zeit in der wir leben ist bestens dazu geeignet. Veränderungen stehen an, wie aus Verzicht ein Gewinn wird, ist keine Frage davon, sich Mangel schön zu reden, sondern die Aufgabe der nächsten Jahre.