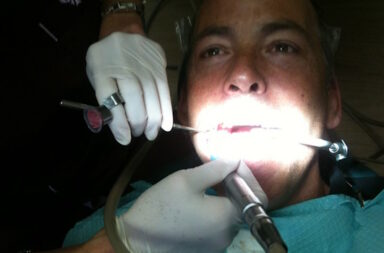Hypermoderne und Altes treffen in vielen Bereichen aufeinander. © Bent Tranberg under cc
Sind wir am Ende? Die Frage klingt reißerisch oder alarmistisch. Vor radikalen Veränderungen stehen wir auf jeden Fall. Das muss nicht schlecht sein.
Es gibt keinen neutralen Blick auf die Welt, wie sie wirklich ist. All diese Vorhaben kann man von Anfang an vergessen, weil jeder Blick eingefärbt ist, sein muss. Philosophen ist längst klar, dass der ‚Blick von Nirgendwo‘ (Thomas Nagel) eine Fiktion ist, andere haben es vielleicht während der letzten Monate erfahren, dass jeder so seine Fakten hat, samt passenden Experten. Der Blick auf die Fakten soll ja angeblich alles klären.
Dann lernt man, dass es natürlich die richtigen Fakten sein müssen, aus den richtigen Quellen, mit dem richten Werkzeug, von den richtigen Experten dargeboten. Dies mag alles sein, aber ist bereits so hoch interpretativ, dass die Aussage, es reiche mal kurz eben auf die Tatsachen oder Fakten zu blicken, nicht mehr als ein netter Glaube ist.
Inmitten unserer Welt, die wir für planbar, rational und dergleichen halten, finden wir radikal konträre Interpretationen, die immer wieder beschrieben wurden und werden und deren Muster kurz gesagt darin besteht, dass die extreme Fraktion der einen Richtung unsere Welt als eine ansieht, die dem Untergang geweiht ist. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern nur wann und wie, während die extreme Fraktion der anderen Richtung uns in der besten Welt sehen, die es je gegeben hat, Zukunftsaussichten wahlweise rosig bis grandios. Dazwischen der Rest, der sich mehr zum einen oder anderen Pol hin orientiert.
Denkmonopole: Alte Ideen sind schlechte Ideen
Positivistische Fortschrittsoptimisten sind häufig durch eine gemeinsame Idee verbunden, nämlich, dass wir alles was alt ist, überwinden müssen. Was früher war mag allenfalls damals seine Berechtigung gehabt haben, aber heute sind wir entweder schon weiter oder wollen weiter kommen. Es geht nach vorne, Probleme werden mit mehr Innovationsgeist überwunden.
Andere Fortschrittsoptimisten würden zugestehen, dass im Fortschritt eine gewisse Dialektik liegt, das heißt, dass wir uns die Fortschritte des einen Gebietes mit einem Rückschritt oder einer Stagnation auf mehreren anderen Gebieten erkaufen, dass sich diese Unwuchten aber einruckeln und wir auf lange Sicht von den Fortschritten profitieren werden. Das Gesamtprojekt ist ein rationales und unterstellt damit, dass eine immer rationalere Welt automatisch eine bessere wäre.
Dazwischen liegen Durststrecken. In ihrer Dialektik der Aufklärung skizzieren Adorno und Horkheimer den Begriff der Aufklärung kritisch und prangern vollkommen zurecht die Unterwerfung allein unter die instrumentelle Vernunft an, also das auch hier oft kritisierte Zweckdenken oder den Funktionalismus. Dieser hat uns inzwischen fest im Griff und selbst wenn sich nur um eine Durststrecke handelte, wäre das schlecht, wenn man selbst drin steckt. Aber vielleicht geht es viel weiter und das immer Forschrittsdenken hat sich einfach verheddert.
Wer ist alles in der Krise?
Die Wissenschaft sei in der Krise, hört man immer wieder mal. Andere leugnen das, halten die Wissenschaft nur für ausdifferenziert und daher schwer vermittelbar. Man sollte auf die Wissenschaft hören, fordern die einen, doch sie kann ihre sehr verschiedenen Disziplinen nicht selbst koordinieren. So liegen die Einzelteile herum, als Werkzeuge und Erkenntnissplitter und wie sie weise und lebbar koordiniert werden, bleibt unklar. Allein die Frage nach der Krise ist jedoch symptomatisch.
Europa sei in der Krise, heißt es. Europa ist ein demografisch schrumpfender und alternder Kontinent, während die Weltbevölkerung, gebremst, weiter wächst. Eine 500 Jahre währende Regentschaft geht damit ihrem Ende entgegen, in der die Nachfolger der Europäer in vielen Teilen der Welt den Ton angaben und zwar über die Machtpolitik hinaus vor allem die Art des Hinschauens, Denkens und Interpretierens bestimmten.
Dadurch ist vor allem der Eurozentrismus in der Krise, die Art, die Welt so zu betrachten, wie man es bei uns eben tut und dies als normal und im Grunde einzig vernünftige Möglichkeit zu empfinden. Zusammengesetzt aus vielen Einzelteilen, die wir als selbstverständlich empfinden, aber eben weil wir genau so zu denken, hinzuschauen und zu bewerten gelernt haben. Einerseits also nur eine Gewohnheit, andererseits heißt das nicht, dass die Gewohnheit irgendwie defizitär sein muss. Es ist halt unser Blick auf die Lebenswirklichkeit, die zum Teil durch eben diese Herangehensweise erst entsteht.
Das materialistische Denken in Teilen, Einzeldingen, Eindeutigkeiten, aber auch Individuen ist ebenfalls in die Krise geraten. Andere Zeiten und Kulturen betonen mehr den Übergang, den Prozess, dass etwas sich verändert und auf dem Weg ist. Wir denken in Ursache und Wirkung und in einem Funktionalismus des Äußeren. Was in uns passiert versuchen wir noch in die Sprache von Hirnfunktionen zu übersetzen. Aber all diese Ansätze haben ihren Punch verloren, erklären längst nicht mehr so überragend, wenn überhaupt nicht, wie das alles funktioniert.
Sind wir am Ende? Das Bündel der eben genannten Prozesse zeigt zumindest, dass sich etwas verändert. Die Karten werden neu gemischt, aber auch unsere bleiben im Spiel.
Der gewohnte Blick auf die Welt
Da der archetypische Blick auf die Welt anders ist, liegt genau hier auch die Hauptproblematik, nämlich ihn so zu vermitteln, dass man ihn auch einnehmen kann. Denn wir sind natürlich durch und durch trainiert, die Welt so zu sehen, wie wir es eben tun. Das erscheint uns normal und alles andere schon ein bisschen abseitig, bis verrückt.
Allerdings haben wir diese andere Seite auch drauf, ganz selbstverständlich sogar. Sie begegnet uns aber in Bereichen, die wir tendenziell eher entwertet haben. Genau hier liegt das Problem. ‚Irrational‘, das hat keinen guten Klang bei uns. Aber wenn unsere Rationalität in aller erster Linie diese aufs Zweckdenken reduzierte Form der Rationalität ist, beißt sich die Katze hier schon selbst in den Schwanz.
Dazu kommt noch etwas: Die Lebenswirklichkeit zwang uns Menschen zu allen Zeiten zu einer gewissen Form von Zweckdenken und Realismus, einfach um weiter leben zu können. Keine Kultur und in gewisser Weise nichts in der belebten Natur ist gänzlich irrational. Das Zweckdenken haben wir seit der Steinzeit drauf. Die eigentlichen Fragen und Deutungen beginnen in dem Moment, wo man sich nach einer konsistenten Gesamterzählung der Welt fragt.
Vermutlich ist es schon falsch, zunächst eine funktionale Lebensweise zu unterstellen, der man dann nachträglich via Erfindung, Schöpfungsmythos oder dergleichen einen Sinn hinzufügen wollte. Wahrscheinlicher ist es, dass der Sinn von Anfang an durch den Ritus gegeben war und sich einzelne Gruppen über genau diese rituelle Art etwas zu tun, die sich vom Alltäglichen unterschied, definierten. Mit unserem funktionalistischen Blick untersuchen wir heute die Welt und glauben zu erkennen, dass sie völlig sinnfrei konzipiert sei und die höchste Form der Erkenntnis soll dann sein, dies aushalten zu können. Das scheint eher der Sonderfall zu sein.
Betrachten wir noch einmal, den gewohnten Blick auf die Welt: Vögel und Insekten haben sich unterschiedlich entwickelt, aber beide verfügen zum Teil über Flügel, mit denen sie fliegen können. Eine ökologische Nische, könnte man deuten, die durch zufällige Mutationen Lebewesen befähigte einen weiteren Lebensraum, die Lüfte, zu erobern.
Wir müssen die Sichtweise, in der nichts geplant und alles zufällig ist, einmal verstehen, denn auch sie hat ihren Reiz und es ist jene Sicht, von der unsere wissenschaftlich geprägte Kultur heute überzeugt ist. Mutationen sind kurz gesagt Kopierfehler im Erbgut und wenn diese Auftreten kommt es in einigen Fällen zu einer Veränderung von Eigenschaften in der nächsten Generation. Einige sind gravierend, andere gering, je nach Ort der Mutation. Nur eine von einer bis 100 Millionen Mutation bringt für das Individuum einen Vorteil. Bringt eine Mutation keinen Vorteil, sieht man sie nie wieder, weil das Individuum früh verstirbt, sich nicht fortplanzt oder die Mutation nach einigen Generationen nicht mehr vererbt wird, da sie sich einfach nicht durchsetzen konnte.
Die eine von Millionen Mutationen, die jedoch einen Vorteil bringt, eröffnet dem Individuum jedoch Vorteile, so dass es biologisch besser an etwas angepasst ist, was bis dahin niemand erschlossen hat, sei es ein Lebensraum oder eine Wahrnehmungs-, Erlebnis- oder Verhaltensweise. Zum Beispiel den der Lüfte, wenn man Flügel hat. Das erklärt auf schlankem Wege ungeheuer viel, die Frage ist nur, ob es alles erklärt, was wir beobachten.
Der andere Blick auf die Welt

Zeus nahm regen Anteil am Leben seiner Mitwelt. © ANA BELÉN CANTERO PAZ
under cc
Der andere Blick auf die Welt setzt die Dinge nicht kausal in Beziehung, sondern im Erkennen von Mustern und Ähnlichkeiten zwischen Ebenen oder Erscheinungsformen der Wirklichkeit, die kausal nach unserem Verständnis nichts miteinander zu tun haben.
Das Problem vor der diese Sichtweise steht ist jedoch, dass eindeutige monokausale Beziehungen, also aus Ursache A folgt immer und eindeutig Wirkung B, in der Lebenswirklichkeit eher die Ausnahmen darstellen. In den meisten Fällen haben wir es mit multifaktoriellem oder mulitkausalen Geschehen zu tun, heißt also, viele verschiedene Ursachen überlagern, verstärken und hemmen einander, dazu kommen noch Rückkopplungseffekte. Das wird sehr schnell unübersichtlich und also muss man wieder ordnen, was denn nun wirklich wichtig ist und welches die Hauptstränge sind.
Hierfür haben wir aber keine Kriterien, das heißt, wir halten den Finger in den Wind, finden dann mal die Gene, mal den Kapitalismus, mal die Neurotransmitter und mal das Kohlendioxid als den Faktor, um den sich alles dreht und drehen sollte und stricken kann um diese willkürliche Entscheidung herum eine Geschichte zu der wir dann die passenden Ursachen suchen und auch finden. Das sieht dann sehr überzeugend aus, nur hat jemand, der andere Schwerpunkte setzt, ebenfalls seine Daten, Fakten, Experten und überzeugenden Erzählungen. Inzwischen sind die Ansätze erkennbar zersplittert und laufen sich tot, weil sie zudem noch mit diversem Unfug konkurrieren müssen, der nicht mal mehr im Ansatz um Seriosität bemüht ist.
Die Liste dessen, was wir eigentlich besser wissen, ohne es letztendlich umzusetzen, ist lang. Weil, … es die anderen ja auch nicht machen, … man ja doch nicht so ganz sicher ist, ob das alles wirklich stimmt, … man ja auch noch was vom Leben haben will und so weiter.
Den anderen Blick kennen wir durchaus, er ist als schnelles Denken (Kahneman), Priming, Vorurteil, analoges Denken bekannt, aber auch als Intuition und als Deutung aus der Psychosomatik oder dem biopsychosozialen Modell, wie es auch heißt. Irgendwie bleibt bei all dem aber ein Rest zurück, der uns unzufrieden macht. Das schnelle Urteil kommt uns manchmal vorschnell vor, es wirkt primitiv oder alternativ, als Leistung eines Genies, die dann wiederum so weit weg ist, dass sie für uns unvermittelbar ist.
In beiden Fällen wehren wir ab, dieses andere Denken irgendwie verstehen zu können, weil es einmal zu primitiv und dann zu genial erscheint. Immer wieder weist man nach, dass, weil jemand mit Bart ein Einbrecher ist, nicht jeder Einbrecher einen Bart trägt und eben auch nicht jeder Bartträger ein Einbrecher ist.
Das stimmt, hier sollte und muss man jedoch nicht stehen bleiben und man macht es sich zu leicht, wenn man immer nur das abwehrt. Die Frage ist eher, wie es auf diesem Weg der Mustererkennung überhaupt zu richtigen Ergebnissen kommen kann, denn das ist es, was wir nicht verstehen, wenn wir näher drüber nachdenken.
Wir können es aber in dem Moment verstehen, wenn wir nicht den Fehler suchen, sondern versuchen zu verstehen. Damit sind wir am Ende einer entwertenden Sichtweise, was ja nicht schlecht ist.
Das große Sortierspiel
Es gibt zig Arten die Phänomene der Welt zu sortieren. Zum Beispiel zeitlich und kausal. Das Abitur kommt immer nach der Geburt, nicht umgekehrt. Man kann sie aber auch alphabetisch ordnen: Anfang, Alltag, Affe, Ampelkoalition könnten dann zusammen gehören. Oder alle Gegenstände, die mehr als 50 Gramm wiegen. Alle grünen Gegenstände. Alle Gegenstände, die durch zwei teilbar sind. Alle, die Obertöne erzeugen.
Kann man manchen, wie man will, nur hat die Menge aller grünen Gegenstände im Grunde nichts gemeinsam, außer, dass sie eben alle grün sind. Man will die Welt aber auch irgendwie sinnvoll sortieren. Sinnvoll kann heißen, dass man bei bestimmten Fragen des Lebens Muster finden kann, aus denen hervorgeht, was man tun und lassen sollte: Wenn man erkältet ist, Kuchen backen will oder sich ein Fahrrad kaufen möchte. Unser Alltag besteht daher aus einer ungeheuer großen Zahl an kleinen, mittleren und größeren Regeln, was, von wem, wann und wie zu machen ist. Viele davon sind implizit und nicht immer sind sie aus den Regeln der Natur ableitbar.
Andere Zeiten und Kulturen hatten und haben andere Verfahren Welt und ihre Wirkkräfte zu sortieren. Ein Beispiel ist die Zeit. Für uns wandert die Zeit gedanklich entlang eines Zeitstrahls, Moment reiht sich ganz linear an Moment. Sie läuft in unserem Weltbild dabei einfach ab oder weiter. Der Abend mit der besten Freundin vergeht dabei zwar subjektiv schneller, als die Zeit im Zahnarztstuhl, aber wir glauben, dies sei ein subjektiver Eindruck und wenn man die Uhr mitlaufen lässt, sieht man, dass 30 Minuten eben immer 30 Minuten sind.
Andere Kulturen kennen so etwas wie Zeitqualität, uns ist das völlig fremd. Wir haben noch eine Restahnung, wir wissen, dass man bestimmte Pflanzen im Herbst nicht säen sollte, dass die dunkle Nacht kein guter Moment ist um draußen etwas zu suchn, aber Zeitqualität im Sinne, dass man jetzt kein Haus bauen sollte, sondern erst in drei Jahren? Wir leben recht konsequent darüber hinweg ein Empfinden dafür überhaupt zu entwickeln. Chronobiologen erzählen uns regelmäßig, dass die ersten Schulstunden sinnlos sind, aber wir haben uns von den natürlichen Rhythmen getrennt und dem Diktat der Uhrzeit und vor allem der Arbeitszeit unterworfen. Der Preis ist durchaus hoch, aber wir meinen, das müsse eben so sein und sei unterm Strich die beste Lösung. Weil wir eben die erfolgreichsten Menschen sind. Der Eurozentrismus machte uns glauben, die anderen seien einfach noch nicht so weit, würden aber, wenn sie entwickelt genug sind, von selbst einsehen, dass wir recht haben. Dass andere Kulturen gar nicht so leben wollen wie wir, sondern bestenfalls Teile unserer Lebensweise übernehmen, macht uns ratlos.
Unsere Wurzeln sind vielfältig: griechisch, römisch und jüdisch, ägyptisch und keltisch seien nur Beispiele, sie glaubten an Götter, aber anders als das Christentum ging es nicht um einen Gott, der die Welt schuf und dann im wesentlichen nicht mehr in sie eingreift, sondern oft um eine Schar von Göttern, die mehr oder minder am Leben der Menschen teilnahmen. Manchmal eingekleidet in Geschichten, in denen sich die Götter und Halbgötter in Tieren oder Personen offenbaren, in anderen Fällen sprechen sie durch Orakel, Träume oder die Kommunikation findet in Templen, Ritualen, mit oder ohne Drogen statt.
Richard Tarnas schreibt:
„Um uns einer so komplexen und schillernden Vision von Welt wie der griechischen zu nähern, empfiehlt es sich, aus ihrem Reichtum eine sehr deutlich erkennbare Eigenheit herauszustellen – die durchgängige Neigung die Welt in archetypischen Formen oder Bildern zu begreifen.“[1]
Um später fortzufahren:
„Es ist für die platonische Sichtweise von elementarer Bedeutung, dass die archetypischen Formen das Primäre sind, die sichtbaren Gegenstände der konventionellen Wirklichkeit hingegen ihre sekundären Ableitungen. Platonische Formen sind keine vom menschlichen Geist durch Verallgemeinerung geschaffene begriffliche Abstraktionen. Sie besitzen viel mehr eine Qualität des Seins, ein Maß an Wirklichkeit, das dem der konkreten Welt überlegen ist. Platonische Archetypen formen die Welt und übersteigen sie zugleich. Sie offenbaren sich in der Zeit und sind doch zeitlos. Sie machen das verborgene Wesen der Dinge aus.“[2]
Über die Menschen der damaligen Zeit schreibt Larry Siedentop:
„Wir müssen uns in eine Welt versetzen, in der die Handlungsnormen ausschließlich die Ansprüche der Familie widerspiegelte, ihre Erinnerungen, Rituale und Rollen und nicht die Ansprüche des individuellen Gewissens. Wir müssen uns eine Welt von Menschen oder Personen vorstellen, die nach unserem heutigen Verständnis keine Individuen waren.“[3]
Thorwald Dethlefsen, Esoteriker, Psychotherapeut und Mytheninterpret spricht davon, dass Archetypen Götter sind. Götter im Sinne von Tarnas, die sich in den Dingen der Welt ausdrücken. Wie dies zu verstehen ist, können Sie bei Bedarf in Analoges Denken nachlesen, wir wollen hier einen weiteren und anderer Zugang wählen. Damit sind die Archetypen aber immer schon Teil der Welt, umgeben uns und wir gehen ständig mit ihnen um. Vielleicht aber auch nur mit einigen von ihnen und das könnte das Problem sein. Dethlefsen fährt fort und sagt, diese Götter oder Archetypen wollen, dass man ihnen opfert und zwar ganz konkret.
Der archetypische Gottesdienst
Das heißt aber nicht unbedingt Blumen hinzustellen oder Kerzen zu entzünden, sondern den Archetypus durch sein Leben aktiv und tätig auszudrücken. Die Götter wollen Aufmerksamkeit, wenn man so will. Schenkt man ihnen diese, so opfert man ihnen und sie sind zufrieden. Tut man es nicht, werden ihre Mahnrufe lauter und wenn man sie beharrlich ignoriert holen sie sich ihr Opfer und man wird gezwungen ihnen zu dienen. Aber auch dies recht unpersönlich, die meinen nicht den konkreten Menschen, sondern verlangen, was ihnen zusteht.
Das ist ein Denken, was in unseren Ohren fremd und etwas gaga klingt, mindestens antiquiert. Eine Interaktion mit einer irgendwie lebendigen oder intelligenten Welt, in der es Ziele gibt, ist in unserem Weltbild nicht (mehr) vorgesehen.
Wir müssen diese Kommunikation mit der Welt der Archetypen wieder neu lernen und mit unserem Weltbild vereinen. Interessant ist das in erster Linie für Menschen, die die Frage: Sind wir am Ende?, eher mit Ja beantworten würden. Am Ende einer bestimmten Art die Welt zu interpretieren. Sie ist maximal ausgereizt, der Ansicht sind immer mehr Menschen, hier werden wir versuchen einen anderen Blick aufzuzeigen und an einigen Beispielen exemplarisch aufzuzeigen.
Quellen:
- [1] Richard Tarnas, Das Wissen des Abendlandes, Patmos 2006, S.5
- [2] Richard Tarnas, Das Wissen des Abendlandes, Patmos 2006, S.9
- [3]Larry Siedentop, Die Erfindung des Individuums – Der Liberalismus und die westliche Welt, Klett-Cotta 2015, S.17