
Die Ehre behalten und das Bein verloren. © Bundesarchiv, Bild 146-1972-062-01 under cc
Viel von dem, was unter Generationenkonflikt läuft, sind eher Generationenfragen, die auf unterschiedliche Erlebniswelten zurückzuführen sind. Dabei gibt es eine Mischung von Erlebniswelten, die tatsächlich, ziemlich unabhängig von Zeit und Kultur, typisch für bestimmte Lebensalter sind und Erlebniswelten, die auf vergangene für die Generation typische Erfahrungen zurückzuführen sind.
Wir überblicken in den letzten Jahrhunderten in der Regel drei, seltener vier Generationen. Heute werden die Menschen älter, dafür sind in früheren Generationen die Kinder eher zur Welt gekommen, das gleicht sich ungefähr aus. Dementsprechend gibt es emotionale Beziehungen am intensivsten in zwischen den Eltern und Kindergenarationen und bis auf Sonderfälle, in denen Kinder aus irgendwelchen Gründen bei den Großaltern aufwachsen oder die Eltern-Kind(er) Beziehung schwer gestört ist, in abgeschwächter Form dann mit den Großetlern.
Die Funktion der Eltern in Kurzfassung
Es ist unmöglich, die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern und umgekehrt knapp darzustellen, weil das ein eigener Kosmos ist. So kann hier nur darauf hingewiesen werden, dass die Beziehung der Eltern zu den Kindern wesentlich eine asymmetrische ist, natürlich vor allem in jüngsten und jungen Jahren, in denen die Kinder völlständig abhängig sind von ihren Eltern. Die Funktion der Eltern ist eine erziehende, sie sind es, die, wie gelungen oder missraten auch immer, den Kindern die Perspektive auf die Welt eröffnen.
Im Alter kann sich das umdrehen Eltern und Kinder können dann zu Freunden werden, doch oft bleiben sie alten in Rollenmustern verhaftet, bei der die Mutter dem 50-Jährigen Kind sagt, es solle sich doch warm genug anziehen. Noch später werden die alten Eltern eventuell hilfebedürftig, was dann zu erneuten Verwerfungen und Verwirrungen führen kann, wenn ein gebrechlicher Mensch noch immer das Regiment, mit einem einzigen Blick oder Wort, führt.
Die Großeltern
Die Großeltern spielen zumeist eine etwas andere Rolle, eine die der Elterngeneration nicht immer gefällt. Die Eltern sind einerseits (alle Aussagen beziehen sich immer auf den statistischen Regelfall, mir ist bewusst, dass es beträchtliche Abweichungen und Ausnahmen gibt) näher am Alltag der Kinder dran, mit all dem Ärger und der Routine, die Alltag eben oft bedeutet. Da liegen Freud, Leid, Bockigkeit und Nerverei oft dich neben einander, während die selteneren Stunden bei den Großeltern einen etwas herausgehobenen Status haben. Es kann sein, dass das manchmal langweilig ist, weil Großeltern und Enkelkinder vielleicht lebensweltlich zu getrennt sind, oft genug verstehen sie sich jedoch erstaunlich gut, nicht selten, weil die Großeltern etwas anders als die Eltern sind, manchmal etwas schrullig sind und sein dürfen und die Erziehungsregeln der Eltern nicht selten schamlos sabotieren, was den Kindern natürlich gefällt.
Die andere Geschwindigkeit der Großeltern ist oft etwas, auf das sich die meisten Enkelkinder einstellen können und die Lebensansätze der Großeltern sind oft in einer eigenartigen Mischung weiter weg und näher dran am Leben der Enkel. Das muss näher erklärt werden: Den Alltag teilen sie in der Regel nicht miteinander, aber die Großeltern haben viel hinter sich, mindestens die Erziehung eigener Kinder und können nicht selten mit einer gewissen Gelassenheit auf das Leben zurückblicken und oft viel entspannter mit den Enkeln umgehen, als mit den eigenen Kindern, damals. Ihr Schwerpunkt mag das häusliche und leibliche Wohl sein, von der Lebensrealität der Jugend sind sie manchmal erstaunlich weit entfernt, doch familiärer Zusammenhalt, Geschichten erzählen, wissen, wer wann Geburtstag hat, das geht immer. Nicht selten treffen sich Familienmitglieder bei der Oma und wenn die dann verstorben ist, hat man kaum noch Kontakt. Die Fokussierung auf das leibliche Wohl und das Unmittelbare, sowie einfach Zeit zu haben ist etwas, was Großeltern und Kinder stärker vereint, während die Generation der Eltern oft mit „Wichtigerem“ beschäftigt ist. Das kann etwas sein, was aus den Augen der Kinder und der Großeltern vielleicht manchmal gar nicht so wichtig ist, aber auch hier gibt es familiäre Besonderheiten, etwa den alten Patriarchen oder die alte Herrscherin, die überall die Strippen ziehen und sich ihre Wichtigkeit nicht nehmen lassen wollen oder können.
Doch über die Art und Weise des Lebensansatzes kommen die Enkel auch noch mit den Lebensfragen der alten Leute in Kontakt und diese sind nicht so heterogen, sondern von Generation zu Generation verschieden. Und viel spricht dafür, dass die Themen der Genetationen und ihr Wechsel heute kurzlebiger geworden sind.
Schimmer der Vergangenheit – Bis zum ersten Weltkrieg
Aus Biographien, aber auch Erzählungen der Großeltern wird die mittlere Generation noch hier und da Erinnerungen an weiter zurückliegende Zeiten mitbekommen haben. Einer meiner Urgroßväter ist sehr alt geworden und einige seiner Nachkommen auch, so dass ich noch mehr oder minder direkt in Kontakt zum Lebensgefühl vergangener Generationen kam, auch über eine längere Freundschaft zu einem 50 Jahre älteren Arzt, die über Jahre ging, bis er schließlich verstarb.
Für die Generation des mittleren und ausklingenden 19. Jahrhunderts galten im Grunde viele Ideale mit denen wir ganz aktuell ringen, ohne, dass wir schon eine gelungene Lösung präsentieren könnten. Die Rollen- und Familienmodelle der damaligen Zeit waren zu einem hohen Grad von der materiellen Abhängigkeit der Frau gegenüber dem Mann geprägt, der in vielen Fällen der unumschränkte Herrscher der Familie war oder diese Rolle wenigstens spielen durfte. Zugleich waren diese Rollen starrer als heute, sie wurden selten hinterfragt.
Ehre und Pflichterfüllung

Der Barkenhoff, eine Künstlerkolonie, in der die Uhren früher schon anders tickten. © Carsten Börger
Wir haben heute das Gefühl, dass bestimmte Begriffe und vor allem die damit zusammenhängenden Gefühle der Verantwortung und des Angesprochenseins verloren gegangen sind. Einerseits klingt ein Begriff wie „Anstand“ zwar anständig, aber irgendwie auch antiquiert. „Pflicht“ hat inzwischen eine Konnotation der Gefangenschaft, dabei war die Pflichterfüllung aus Einsicht in die Notwendigkeit mal einer der edelsten Begriffe. Besonders belastet ist der Begriff der „Ehre“ bei uns. Die einen denken dabei sofort an die sogenannten „Ehrenmorde“, die anderen haben dabei völkische Assoziationen von Ehre und Vaterland.
Dabei ist es ja nicht falsch, etwas als Ehrensache zu betrachten oder sich geehrt zu fühlen. Gut 100 Jahre zurück war auch bei uns der Begriff der Ehre unproblematisch und positiv aufgeladen. Seine Ehre zu verlieren, erschien entsetzlich und wurde mitunter als ein schlimmerer Verlust empfunden, als einen Arm, ein Auge oder sogar sein Leben zu verlieren. Der Gedanke, für eine Idee, ein Ideal sein Leben zu lassen, der Gedanken, dass die Ehre zu verlieren schlimmer als der Tod ist, der uns heute so fremd und unzivilisiert erscheint, war vor etwa 100 Jahren bei uns durchaus verbreitet.
Dass man jemanden attraktiv findet, weil ihm die Uniform so gut steht, ist ein für heutige Verhältnisse einerseits ferner Gedanke, wenn man jedoch Uniform als das sieht, was angesagt ist, könnten es die Tattoos am Hals, das Piercing und der Vollbart sein, der eben heute einige Männer attraktiv erscheinen lässt.
Der Umgang mit Autoritäten
Als ich einmal meine kurz nach dem Beginn des 20. Jahrhunderts geborene und natürlich in dieser Zeit sozialisierte Oma zum Arzt brachte, erzählte sie mir, dass der Arzt ihr weh getan hätte und sie die Untersuchung so eigentlich kein zweites Mal wolle. Ich fand das vollkommen einsichtig und sagte ihr ganz ohne Hintergedanken, dass sie das doch dem Arzt sagen solle. Meine Oma lachte, als wenn ich einen guten Witz gemacht hätte, aber ich verstand zur damaligen Zeit die Pointe nicht richtig, sozusagen ein generationenbedingter Übersetzungsfehler. Für meine Oma war es vollkommen unmöglich einem Arzt zu sagen, er solle etwas anders machen, das wäre wie Gotteslästerung gewesen. Das allerdings war mir damals nicht klar.
Die Autoritätspersonen früher waren der Arzt, der Lehrer, der Pfarrer, der Polizist das waren die Menschen, die gebildet waren und lesen konnten und es waren fast immer Männer. Künstler wie Heinrich Heine, Carl Spitzweg, Wilhelm Busch, Gustav Meyrink, Kurt Tucholsky und Karl Kraus demonstrierten beispielhaft und in bunter Aufzählung, dass es mit der bedingungslosen Autoritätsgläubigkeit auch in früheren Zeiten nicht in allen Bereichen der Gesellschaft weit her war. Und in Künstlerkolonien wie dem Barkenhoff in Worpswede und dem nahen Fischerhude waren schon damals auch immer wieder Frauen herausragend. Doch Künstler waren zu allen Zeiten Sonderlinge, nicht selten die Avantgarde der Gesellschaft und für den Mainstream galt, dass der Mann das Sagen hatte und das nicht selten in einer diktatorischen Art und Weise, wenigstens jedoch in einer gewissen, als natürlich empfundenen Dominanz.
Das hatte neben für uns heute relativ offensichtlichen Nachteilen, auch Vorteile, neben einer größeren gesellschaftlichen Klarheit und Stabilität der Rollenmuster, gab es – durch diese auch bedingt – einen intensiveren Ödipuskomplex, wie in Warum wir den Ödipuskomplex brauchen und Narzissmus in der Gesellschaft dargestellt und ich glaube, die Bedeutung dieser ödipalen Wirkung/stabilisierenden Funktion wird heute dramatisch unterschätzt und brächte Licht in und Lösungsansätze für so manche Diskussion, die wir heute unter der Überschrift politisch führen und in denen sich Generationenfragen ganz praktisch verbergen.
Die Tugenden, auf die man sich irgendwann offensichtlich mal verlassen konnte, zerrinnen uns heute zwischen den Fingern, zumindest ist das der Eindruck, den man manchmal haben kann.
Zwischen den Weltkriegen
20 oder 30 Jahre und ein Weltkrieg später entsteht aus dem Deutschen Kaiserreich die Weimarer Republik und geht schnell in die Goldenen Zwanziger über, die allerdings kürzer währten, als der Name vermuten lässt. Es war noch immer recht normal ein halbes Dutzend Kinder zu haben und der inzwischen einsetzende demographische Knick war unbemerkt, weil auf hohem Niveau. Die Bevölkerung war jung und vital, man wollte leben, fühlte sich jedoch auch kollektiv gekränkt und gedemütigt und schnell wich die aufkommende Lebenslust der Verunsicherung der Weltwirtschaftskrise.
Deutschland war in dieser Zeit alles andere als ein Entwicklungsland, sondern ein Land der Dichter und Denker, das inzwischen auch Tatkraft zeigte, in kriegerischer aber auch technischer Hinsicht. Vielleicht war der Einfluss des deutschsprachigen Raums nie größer als in den letzten Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn man die Epoche über die Romantik bis in die Klassik zurück verfolgt. Umso ärger die Demütigung und umso stärker der Wunsch nach sozialem Ansehen.
Auch das hat mit Begriffen und Gefühlen des Stolzes, der Ehre und der Selbstachtung zu tun, 1917 erst wurden in Deutschland Duelle gesetzlich verboten. Die Idee war grundsätzlich bereit zu sein für seine Überzeugungen oder die Aufrechterhaltung der Ehre zu sterben. Menschen, die in dieser Generation sozialisiert wurden nahmen die Stimmung und Haltung mit und frühe Einstellungen verliert man auch nicht mehr so schnell. Gerade mal 100 Jahre ist es her, da diese Haltung abebbte, ausdimmte. Was ist davon geblieben?
Nach dem Zweiten Weltkrieg
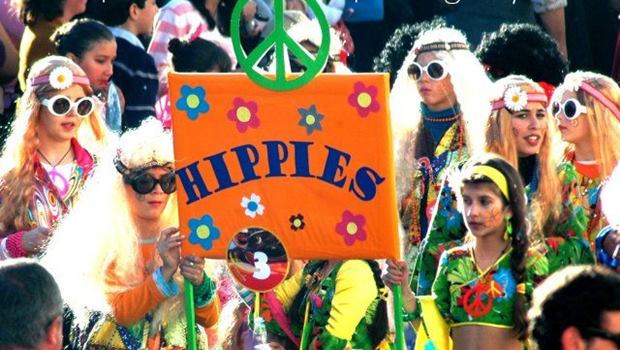
Die Sehnsucht nach der Hippie Ära besteht weiter. © Gustavo Veríssimo under cc
In und nach dem Zweiten Weltkrieg lag alles in Schutt und Asche. Schlagartig wurden die Themen der damals geborenen und aufwachsenden Generation anders. Es ging ums Überleben, um Hunger und darum, das Nötigste zu haben. Armut und Hunger waren Themen in einem Land, dass das lange nicht mehr kannte und zwar besonders in der Jahren noch Kriegsende bis zur Währungsunion. Essen, Wohlstand und Besitz waren erstrebenswert in der damals aufwachsenden Generation, in einem ganz existentiellen Sinn.
Daher auch oft der Schulterzucken der damals Jungen, heute 70 bis 80-Jährigen, die gar nicht verstehen konnten, was ihre Kinder für Probleme mit dem Leben hatten. Denn für diese Generation war klar, wenn man endlich wieder etwas zu Essen hatte und immer mehr Wohlstand ansammeln konnte, was im Wirtschaftswunder beeindruckend gelang, dann hatte man es geschafft. Die ebenso überraschend gewonnene Fußball WM von 1954 sorgte dann dafür, dass man nicht nur, wieder etwas hatte, sondern auch wieder wer war. Die Zeit des Nationalsozialismus wurde in der ersten Jahren nach dem Krieg nicht aufgearbeitet und in vielen Familien erzählten die Männer, die den Krieg auf die eine oder andere Art erlebten, dasselbe: nämlich nichts.
Das übernahmen dann die Nachkommen, die jene Fragen stellten, die die Eltern nicht stellen wollten oder konnten. Erst die Kinder konfrontierten was in der Nazizeit geschah und fragten mit einem gewissen Unglauben, auf der anderen Seite manchmal auch ohne Verständnis für die Situation der Eltern, warum sie nichts getan haben, ob sie tatsächlich nichts gewusst haben und warum sie nichts erzählen. Vieles konnten die Eltern vielleicht selbst inzwischen nicht mehr verstehen und die immer bohrenderen Fragen führten tedenziell zu immer mehr Verstummen. Über eigene Gefühle zu reden fällt dieser Generation oft heute noch so schwer, wie die Gefühlsäußerungen anderer zu ertragen.
Die Nazizeit ist in den Familien eben nicht das große Thema gewesen, für die Elterngeneration, die im Krieg erwachsen oder jugendlich war, war es der materielle Wohlstand und das soziale Ansehen. Es musste ja weiter gehen. Und so wurden einige Werte, die vor dem Krieg tradiert wurden, auch in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in die 1950er übernommen. Erst einmal war Verdrängung angesagt, mit Pflicht, Fleiß und jenen Werten, die man noch rettete. Man wollte mit all dem nichts mehr zu tun haben und lieber zeigen, was man wieder hatte, auch wenn Schonbezüge klar machten, dass die kostbaren Stücke eher der Präsentation diente, als dem eigeen Wohl- und Wohngefühl. Die Fragen stellten die, die „die Gnade der späten Geburt“ ereilte, manchmal auf einem moralisch sehr hohen Ross sitzend.
Die 68er
Doch längst nicht alle, die in den ausklingenden 60er Jahren jung waren, waren Rebellen, noch wollten sie welche sein. Aber die Proteste der Studenten, gegen das Establishment, gegen die Tradierung von Werten um ihrer selbst willen schwappte auch auf die Normalbevölkerung über. Längst nicht alle waren Flower-Power-Hippies und praktizierten im Drogenrausch singend und tanzend die freie Liebe, aber es änderte sich ein bisschen was und wenn es nur die Frisuren und Klamotten waren, die Haare wurden länger, die Röcke kürzer, die Inneneinrichtung bunter und plastiklastiger, die Musik wilder.
Die alten Werte wurden verabschiedet, jene Vorstellungen von Ruhm, Stolz und Ehre, bei denen man blind folgte und darüber hinaus wurden noch all jene Tugenden hinterfragt, die man nicht unbedingt brauchte, denn Tradition galt als spießig und reaktionär, in all ihrer Autoritätshörigkeit. Eine neues Verständnis von Freiheit machte sich breit und ein neues Rollenverständnis.
Man wollte endgültig nicht mehr so sein, wie die Eltern, hatte erst einmal genug von den Idealen von Sauberkeit, Ordnung, Fleiß, Pflichten und den preußischen Tugenden. Viele der 68er waren jene Kinder, die in der Kriegs- oder Nachkriegszeit noch selbst Mangel litten, sie opponierten gegen ihre Eltern, aber in der Opposition verstanden sie den Materialismus und den Wunsch nach sozialer Anerkennung der Eltern noch, sie wussten genau wogegen sie waren. Menschen, die in den späten 1940ern und frühen 1950ern aufwuchsen, kannten die Steifheit, Strenge ud soziale Kälte noch, bei der zählte und in der Klasse abgefragt wurde, was der Vater von Beruf war und in dem die gute oder schlechte Herkunft wichtig war.
In der Not rückte man zusammen, der eine Krauthobel wurde von Haus zu Haus herumgereicht, doch als es den Menschen wieder besser ging, separierte man sogleich. Auch dagegen protestierte man, gegen eine Gesellschaft aus Klassen und Restriktionen und wenn viele auch nicht laut mitprotestierten, so hatten sie doch wenigstens nichts dagegen und Deutschland wurde in den späten 60er ziemlich neu definiert. Die allermeisten profitierten davon, die Älteren ließen über sich ergehen, was ihnen als Untergang vorkommen musste, doch wie man weiß argwöhnten schon die Sumerer 3000 Jahre zuvor, dass die Jugend verroht sei und daher das Ende unmittelbar bevorstehen müsse.
Die Kinder der 68er
Interessant war auch, was nun einsetzte. Wussten die 68er noch wogegen sie kämpften, konnten sich deren Kinder sozusagen ins gemachte Nest setzen. Ein Mangelempfinden wie es für die meisten ihrer Eltern noch obligatorisch war? Fehlanzeige. Die großen ideologischen Schlachten waren mehr odert weniger geschlagen, es waren Kinder, die in Zeiten aufwuchsen, die vielleicht seit sehr langer Zeit die besten waren und vermutlich auch für lange Zeit nicht wieder so gut sein werden. Natürlich, individuellen Schicksale gab es auch hier, aber nun konnten Biographien mit individuellen Schicksalsschlägen erstmalig Beachtung finden. Nicht, dass es die nicht auch vorher, vielleicht sogar auch weitaus größerem Umfang gegeben hätte, es hat nur niemanden interessiert.
Die schweren Schicksale und Missbrauchsfälle aus Heimen, die heute zum Teil aufgearbeitet werden, stammen zumeist aus den 1950er Jahren. Nun also wurden die Einzelschicksale, die früher still weinend, abspaltend, depressiv, trinkend oder sonst wie ertragen werden mussten, weil sie unter normal oder „sprich nicht drüber“ liefen auf einmal interessant – weil der Boden jetzt fruchtbar war. All die Jahre und vielleicht Jahrzehnte davor hatte man einfach auf die eine oder andere Art zu funktionieren. Wenn die soundsovielte Nacht in Folgen die Sirenen wegen der Fliegerangriffe ertönten und alle zusahen, dass sie möglichst schnell in den Bunker kamen, bevor die todbringenden Bomben fielen, dann war kein Platz zu fragen ob das auch kindgerecht oder der Biorhythmus irritiert ist. Und das soll keine spöttische Bemerkung sein.
Die Kinder der 68er lebten in einer anderen Welt. Hunger und Mangel an Wohnraum waren keine Themen mehr, die Mittelschicht wurde zusehens breiter und wohlhabender, nach dem Beruf des Vaters oder der Herkunft wurde allenfalls hinter vorgehaltener Hand gefragt. Es mangelte ihnen an wenig, sie wurden in eine freiere, wohlhabendere und vielfach liberalere Welt hineingeboren. Mit einem Wort, es könnte und sollte ihnen besser gehen, als vielen Generationen zuvor, doch auf einmal tritt ein sonderbares Phänomen auf. Gerade die Generation mit den vermeintlich besten Startbedingungen seit langem bekommt auf einmal Probleme mit dem
Leben, nicht selten psychischer Art. Angststörungen und Depressionen treten zum ersten Mal in einem größeren Stil ins Bewusstsein.
Es ist nach wie vor unklar, ob diese Störungen tatsächlich zugenommen haben, oder nur häufiger diagnostiziert werden, mehr Beachtung fanden sie auf jeden Fall. Stoff für Generationenfragen gaben sie auf jeden Fall her. Erst verstand die Nachkriegsgeneration ihre Eltern nicht, jetzt verstehen sie ihre Kinder nicht mehr. Was war los?
Erklärungsversuche
Die Kinder hatten nun auf einmal eines: Zeit. Vielleicht haben wir heute sogar mehr Zeit als die 68er Kinder, aber heute hat man das Gefühl wenig Zeit zu haben. Das war damals anders. Es bestand kein Grund zu hetzen. Es gab keine Smartphones, kein Internet, nicht einmal Fernsehen Nonstop und keinen Blick auf die Karriere, die einen dazu bewog, sich schon als 13-Jähriger um Praktika in den großen Ferien zu bewerben. Man wollte nicht kollektiv perfekt werden, die Angst zu versagen war noch nicht da. Aber oft Angst, Grübelei.
Für viele Kinder dieser Generation war sicher viel Zeit zum Nachdenken da. Das war gut, aber auch neu. Gegen die Eltern brauchte man nicht mehr zu kämpfen, nur noch aus persönlichen Gründen, aber ein Problem war auch, man konnte nicht kämpfen. Die Eltern hatten jede Menge Verständnis für ihre Kinder, zugleich war dies die erste Generation, die das neue Verhältnis von Mann und Frau (nach den Künstlern) in die Realität umsetzten. Die Vaterrolle war in den meisten Fällen weniger dominant, ein Nachlassen der ödipalen Konstellation war inklusive, damit aber auch ein Wegfallen des Schutzes vor anderen außerfamiliären Einflüssen. Es war mehr Offenheit, aber weniger Struktur da.
Viele 68er Eltern (vielleicht noch eher die Väter) stammen aus einer Zeit in der sie den Zweiten Weltkrieg noch miterleben und verarbeiten mussten – als Kind. Wir können verstehen, dass Menschen vollkommen traumatisiert aus dem Krieg zurück kehrten, nach dem Ersten Weltkrieg, gab es für die gebrochenen Seelen die Entsetzliches erlebt haben müssen den Begriff der Kriegszitterer, die wir heute als schwere posttraumatische Belastungsstörung verstehen.
Eigenartigerweise prägten Kriegszitterer nicht das Bild nach dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht kompensierten die Soldaten anders, in jenen Jahren. Die Kinder, die Krieg erlebten konnten ihn nicht begreifen, sie waren nicht an der Front, aber in Luftschutzbunkern, die hörten das allabendliche Heulen der Sirenen, sie sahen Tote, Zerstörung, hörten Bomben. Eines der probaten Mittel, wenn man einer Situation psychisch nicht gewachsen ist, ist die Abspaltung. Wenn etwas abgespalten ist, ist es erst mal weg, dann gibt es zunächst auch kein Problem mehr. Wir stellten den Mechanismus in Ich-Schwäche ausführlicher vor.
Der Preis ist eine Einbuße der Empfindungsfähigkeit, der Empathie. Man funktioniert gut genug, um seinen Job zu machen, manchmal auch, um eine Familie zu gründen, doch wer nie erfahren hat, als Kind nach den eigenen Bedürfnissen gefragt zu werden, einfach weil keine Möglichkeit war, diesen gerecht zu werden und es Priorität hatte, das Überleben sichern, der wird das kaum weitergeben können. Eine Zeit in der Kinder mit abwesenden Vätern groß wurden, zum einen solche, die real im Krieg starben oder in Gefangenschaft gerieten, doch auch im übertragenen Sinne die Kinder jener Eltern, die traumatisiert waren, oder in dieser Zeit Kinder waren und selbst traumatischen oder chronisch aggressiven Bedingungen ausgesetzt waren.
Im Grunde muss man den Hut davor ziehen, wie diese Menschen das Land wieder aufbauten und einfach weiter machten und vor ihren Kindern dafür, wie mutig und offensiv sie die Wunden angingen. Doch selten – und das wird erst heute klarer – konnten sie ihr eigenes Leid verarbeiten. Doch verdrängtes oder verleugnetes Leid ist nicht aus der Welt und auf einmal steht die nächste Generation, die Kinder der 68er in dieser äußerlich heilen Welt, oft genug vor einem psychischen Trümmerhaufen, der nur oberflächlich weggeräumt wurde.
Vielleicht war es der Druck stiller Erwartungen, vielleicht ein dauerndes Gefühl latenter Spannungen in der Familie, die die Kinder mitbekamen und ihrerseits nicht verarbeiten konnten. Durch die geschwächten oder abwesenden Väter fiel aber nun eine innere Schutzfunktion weg, die psychische Struktur ausgerechnet dieser Kinder war schwächer. Sicher nicht aller, aber doch in einem Ausmaß, dass die Diskrepanz erklärt, dass Kinder und Heranwachsende Schwierigkeiten haben in der besten Welt seit langen Jahrzehnten Fuß zu fassen. Wie ein Staffelstab werden die Probleme, wenn sie unbearbeitet sind, von Generation zu Generation weiter gegeben, die Folge ist ein Aufblühen schwerer Persönlichkeitsstörungen, bei denen ebenfalls umstritten ist, ob sie tatsächlich zugenommen haben oder nur stärker bemerkt wurden, denn das Bewusstsein um die Bedeutung dieser Gruppe psychischer Erkrankungen kam just zu jener Zeit langam den Forschern in den Sinn, in der die Kinder der 68er groß wurden.
Natürlich war es keinesfalls zwingend, dass es Probleme geben musste und selbst, wenn es welche gab, das Leben ging weiter, neue Generationen wuchsen heran. Bis zur Zeit der Kinder der 68er, die auch Generation X genannt wird, sind wir gekommen. Den darauffolgenden Generationen bis heute und ihren spezifischen Generationenfragen widmen wir uns im nächsten Beitrag.



