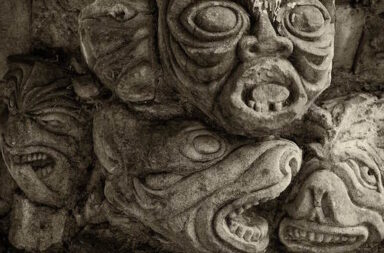Das dreifache Wohlstandsparadoxon

Die Slums der Welt gleichen sich überall, hier die dunklen Ecken von Kairo … © Michał Huniewicz under cc
Wir wollen keine Welt in der Kinder verhungern, Menschen in dem Elend von Slums leben, bettelarm sind oder unter unsäglichen Bedingungen arbeiten müssen. Wir wollen auch die Umwelt nicht vergiften, die Atmosphäre aufheizen und unseren Kindern, Enkel und Ur-Enkeln auch kein Trümmerfeld hinterlassen, auch Menschen ohne eigene Nachkommen verachten ja nicht die kommenden Generationen.
Das erste Paradoxon des Wohlstandes ist nun, dass es gute Gründe gibt, ihn für alle anzustreben, auf der anderen Seite ist es genau dieser Wohlstand, der die Welt zerstört. Die meisten Menschen, die in Armut leben, haben einen ökologischen Fußabdruck, der für die Welt nicht schädlich ist, so gut wie alle Menschen aus fortschrittlicheren Ländern haben einen, der die Welt in die Knie zwingt. Es kann aber kaum unser Ziel sein, dass alle Menschen in Armut leben, damit es allen gut geht, denn Menschen in Armut haben kein gutes Leben. Sind wir also zu viele Menschen geworden? Vielleicht, aber damit kaufen wir uns – neben anderen Problemen, die sich darum drehen, wie man die Weltbevölkerung denn nun so reduzieren soll, dass nicht mehr Leid erzeugt als vermieden wird – gleich ein weiteres Paradoxon des Wohlstandes ein.
Mehr Wohlstand bedeutet in aller Regel weniger Kinder, von daher sollten wir also doch wieder ein Interesse an mehr Wohlstand für alle haben, nur bedeuten weniger und gebildetere Kinder dann auf lange Sicht wieder, dass die Menschen, die älter werden nicht ausreichend gepflegt und im Alter versorgt werden, dass ist das Problem, was wir aktuell bei uns sehen können. Es gibt nicht genügend Arbeitskräfte in der Alten- und Krankenpflege, importieren wir diese aus anderen Ländern, kommt es dort zu sozialen Verwerfungen, von denen man kurzfristig profitiert, die aber mittelfristig ebenfalls zum Bumerang werden. Und ob bezahlte Kräfte ein Ersatz für eigene Familien sind, steht noch mal auf einem anderen Blatt, so dass die Formel oft lautet mehr Wohlstand = weniger Kinder = ein weniger gutes Leben im Alter. Jedenfalls unter den gegenwärtigen Bedingungen.
Das führt zum dritten Wohlstandsparadoxon, das darin besteht, dass wir, wenn wir wirklich wollen, dass es uns gut geht, im Grunde dafür sorgen müssen, dass es anderen auch gut geht. Das ist eine an sich schöne Erkenntnis, aber eine, die nicht so gut zum Weltbild vieler Menschen bei uns passt, die erst einmal sich hinreichend absichern möchten und wenn dann noch etwas übrig bleibt, mehr oder weniger gerne etwas abgeben. Die gelernt haben, dass es mir nur gut gehen kann, wenn es anderen schlechter geht.
Von gefühlten Freiheiten und Rechten
Wir sind oft sehr feinfühlig, wenn es um unsere Freiheiten und Rechte geht. Mehrmals im Jahr in den Urlaub zu fahren, neuerdings gerne auch mit Kreuzschiffen, das erscheint manchen schon als eine Art Grundrecht. Mit katastrophalen Folgen für das Klima, aber wir haben immer noch mehr Mechanismen wegzuschauen, als dies wirklich zu sehen und unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Wir werden immer mobiler und wollen es werden, andere Teile der Welt auch. Vielleicht geht alles gut und wir fahren am Ende alle mit Ökostrom aus regenerativen Energiequellen, das wäre ein echter Meilenstein, aber es wird schon recht eng.
Dazu kommt, dass unsere Lebensweise von Urlauben, weltweitem Handel, globalisierter Produktion und Geschäftsreisen, wie wir aktuell erleben, die Gefahr von Pandemien dramatisch erhöht. Sind von der gesamten Geschichtsschreibung bis zum 19, Jahrhundert 25 Epidemien- und Pandemien überliefert (auch wenn vielleicht nicht alle erfasst wurden), so sind es im 19. Jahrhundert allein schon 12, im 20. Jahrhundert dann 17 und in unserem bis 2020 schon 25.[1] Kein so richtig guter Trend. Wir haben ungleich bessere medizinische und logistische Möglichkeiten, aber diese Logistik bringt wiederum andere System an den Rand, wie wir gerade ebenfalls erleben.
Die Entwicklung der Wirtschaft ist unklar, der Motor ruckelt, eine lange und tiefe Krise sehen durchaus viele, was wiederum für die Renten und privaten Vorsorgen eifriger Sparer nichts Gutes heißt. Auch hier ist eine Punktlandung denkbar, denn ein vornehmlich auf Wachstum basierendes Wirtschaftssystem erscheint vielen ohnehin überholt, nur fühlen sich dann wieder viele Menschen um ihr Lebenswerk betrogen. Und Seuchen im Jahrestakt sind nun auch keine helle Freude, das alles hebt die Stimmung nicht.
Das Trinkwasser wird knapper, der Müll dafür immer mehr und in den meisten Fällen sind diejenigen, die den größten Schaden verursachen nicht diejenigen, die den größten Schaden erleiden. Auf längere Sicht bleiben jedoch auch die reicheren Länder nicht verschont, wir sehen die braunen Wiesen schon, wir spüren die heißen Sommer, Covid-19 lehrte auch uns das Fürchten, die Folgen spüren wir alle.
Die Geschichte ist offen. Versuchen wir alle schnell noch unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen, weil der Mensch eben so ist? Die Meinungen gehen auseinander. Viele Menschen meinen es ernst und leiden darunter, dass sie gerne würden, aber keine hinreichenden Angebote finden. Ob die #MeToo Debatte, die aktuellen Proteste gegen Rassismus oder die Fridays for Future Demos, eine Skepsis gegenüber einem Wirtschaftssystem, das auf Wachstum setzt, es brodelt etwas, in der westlichen Welt, was insofern gut ist, weil wir in vielen Bereichen zu den größten Verursachern von Missständen gehören und zugleich ein erwachendes Problembewusstsein besitzen.
Wie viel ist zu viel?
Wann wir definitiv zu viele Menschen sind, kann nicht beantwortet werden, denn es kommt nicht allein auf die Anzahl der Menschen an, die auf der Erde leben, sondern in erster Linie darauf, wie wir leben. Sollten demnächst die meisten Chinesen, Inder und Afrikaner Autos mit Verbrennungsmotor fahren, vermehrt Reisen, Heizungen und Klimaanlagen benutzen, könnte es sein, dass wir heute schon zu viele sind, was zur Folge hätte, dass viele Menschen bald darunter leiden müssten. Aber mit welchem Argument will man es ihnen untersagen?
Wenn wir einen Bewusstseinssprung schaffen und sich schon mal in der westlichen Wertewelt vieles ändert, hätte das zum einen den direkten Effekt, dass viele der Hauptverursacher problematischer Verhaltensweisen sich verändern. Zudem geht noch immer eine Sogwirkung vom Westen aus, die sich abschwächt, aber noch ist sie vorhanden. Dass wir die Aufgabe hätten, die Welt zu bekehren, glauben wir inzwischen selbst immer weniger, aber man kann versuchen ein Vorbild zu sein.
Dass auch wir zunehmend leiden, ist insofern eine Chance, weil sich diejenigen ändern können, auf die es ankommt. Wenn andere Menschen Probleme haben, wird die Welt enger, ganz buchstäblich. Das kann uns insofern nicht egal sein, weil wir uns vor den Migrationsbewegungen fürchten. Ein weiteres Mal liegt es im eigenen Interesse, dass es anderen gut geht. Die Alternative wäre, die Grenzzäune immer höher zu ziehen und immer verbissener zu verteidigen, nur kann man nicht so lange in einem moralischen Widerspruch leben und die Nachteile würden auch hier die Vorteile überwiegen, jedenfalls für einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung.
In einer enger werdenden Welt gilt mehr denn je, dass wir uns um andere kümmern müssen, wenn es uns gut gehen soll. Gleichzeitig wollen wir unseren Lebensstandard aber auch nicht weiter einbüßen.