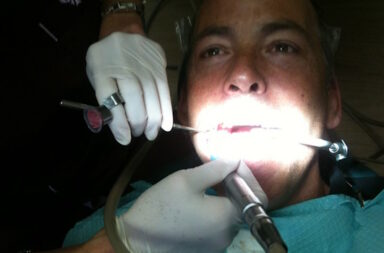Kranksein im Bett in früheren Zeiten. Sicher stilisiert, aber doch auch als Auszeit erkennbar. © simpleinsomnia under cc
Über das Kranksein zu schreiben, heißt, immer nur bestimmte Aspekte, Gedankensplitter herausgreifen zu können. Zu umfassend ist das Thema.
Dennoch hoffe ich, dass die innere Beziehung zwischen einigen Bereichen hier und da sichtbar wird.
Die Grenze, die man nicht kennt
Es scheint nur auf den ersten Blick einfach zu sein, dann hört es sich in etwa so an: Man kommt in den meisten Fällen halbwegs gesund auf die Welt, wächst gesund auf, das ist der Normalzustand, aus dem einen dann hin und wieder die eine oder andere Krankheit herausreißt. Bis schwere Krankheiten einen treffen, vergehen in der Regel etliche Jahrzehnte, im Alter scheint das leider oft unvermeidlich. Doch bis dahin ist man, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, in der Regel gesund. Der gesunde Mensch, ist also der Normalfall. Wirklich?
In den Buch Krankheit als Weg von Thorwald Dethlefsen und Rüdiger Dahlke ist eine Untersuchung von E. Winter aus der Jahr 1959 aufgeführt, in dem in Interviews mit 200 Gesunden folgende Beschwerden heraus kamen:
„Verstimmungen, Magenbeschwerden, Angstzustände, häufige Halsentzündungen, Schwindel, Ohnmacht, Schlaflosigkeit, Dysmenorrhoe, Obstipation, Schweißausbrüche, Herzschmerzen, Herzklopfen, Kopfschmerzen, Ekzeme, Globusgefühl, rheumatische Beschwerden.“[1]
In absteigenden Prozentanteilen, von 43,5 bis 5,5%.
Gut, könnte man sagen, 1959, ist ja nun schon sehr lange her, seit dem hat sich so viel verändert, dass man das nun wirklich nicht mehr vergleichen kann. Doch 2013 erschien ein Artikel in The Lancet, auf den in der Welt Bezug genommen wird:
„Demnach ist die Menschheit alles andere als kerngesund: Im Jahr 2013 hatte nur einer von 20 Erdenbürgern kein gesundheitliches Problem. Mehr als ein Drittel hat fünf und mehr Beschwerden. Die Zahl derer, die mehr als zehn Krankheiten mit sich herumtragen, stieg um 52 Prozent.“[2]
Führend sind Rückenschmerzen und Depressionen, es folgen Eisenmangel, Angsterkrankungen, Hörprobleme, Nackenschmerzen und Beschwerden des Bewegungsapparats. In Europa Stürze.
Aber trotzdem gibt es doch diese Grenze zwischen krank und gesund, oder? Nun, man hat sie nie gefunden oder befriedigend definieren können. Subjektive Kriterien haben den Nachteil, dass man sich kerngesund fühlen kann, doch der Körper ist schon voll mit Krebs. Objektive haben den Nachteil, dass die Untersuchungen immer wieder zum Vorschein bringen können, man habe nichts, aber man sich hundeelend fühlen kann. Eine Mischung klingt gut, aber wie soll die aussehen? Es bleibt ein Rest von Willkür.
Kranksein
So wenig, wie es die schroffe Unterteilung zwischen krank und gesund in sinnvoller Weise gibt – für den Hausgebrauch schon – so wenig gibt es die eine Art des Krankseins. Im Kranksein laufen dann mehrere Linien zusammen, die man guten Gewissens als psychosomatisch oder biopsychosozial bezeichnen darf. Gemeint ist das Zusammenspiel. Ein Sandkorn im Auge muss man nicht als psychosomatisch bezeichnen, aber schon diese minimale Ursache hat psychische Auswirkungen und wird als außerordentlich störend erlebt.
Kranksein hat eine gesellschaftliche Folge, etwa, indem man bei der Arbeit ausfällt. Aber Kranksein hat auch noch eine kulturelle Komponente. Ich weiß gar nicht, ob diese Disposition in ‚der deutschen Seele‘ in besonderer Weise angelegt ist, zumindest ist hier viel zu finden. Thomas Manns Der Zauberberg ist ein vielschichtiges Buch. Der Aufhänger ist die Geschichte des jungen Hans Castorp und seiner Reise in ein Lungensanatorium in Davos und gleich zu Anfang erfahren wir, dass hier auf dem Zauberberg die Zeit so sonderbar anders vergeht. Mit dem Überschreiten der geografischen und Höhengrenze, treten wir gleichzeitig in eine ganz seltsame Zeitzone ein.
Hier oben ist das Leben von eigenen Rhythmen bestimmt, die sich um das Wetter aber vor allem auch um den Alltag im Sanatorium und das Kranksein, die Tuberkulose dreht. Und natürlich um die Irrungen und Wirrungen der großen Themen, wie Weltanschauungen, Liebe und menschlichen Charakterzügen. Die vielleicht im Kranksein noch mal deutlicher, regressiver hervortreten?
Doch nicht nur auf dem Zauberberg ist Kranksein die Grenzüberschreitung zur Anderswelt, das gilt für andere Institutionen auch. Für den Arztbesuch und das Krankenhaus. Wenn der Tod der große Gleichmacher ist, dann ist die Krankheit ein mittelgroßer. Denn, egal wer man ist, spätestens im Krankenhaus ist man in aller erster Linie Patient. Ein seltsames und wie man immer wieder lesen kann an sich irrationales Ritual. Wer ins Krankenhaus kommt, bekommt ein Bett zugewiesen. In der Regel wird man auch seiner normalen Kleidung beraubt und hat ein Engelhemdchen zu tragen oder eben den krankenhaustypischen Funktionslook: Leggins, Joggingklamotten, Schlappen.
Auf den de luxe Stationen, der Reichen und Schönen wird mehr Exklusivheit suggeriert, der Fernseher ist breiter, das Essen besser, die Zimmer wie im Sterne Hotel, der Arzt gerne der Chefarzt. Doch letztlich ist man auch hier primär krank.
Von der Kur zur Reha – und das Internet
Einbrüche in diese Anderswelt gibt es dennoch. Die Kur, das war so ein merkwürdiges Zwischenreich. Hier trafen sich dereinst Vorsorge und Nachsorge. Zur Kur ging man, man bekam sie vom Arzt verschrieben, damit man nicht krank wird. Oder nicht wieder krank wird, auch nach einer Krankheit, zur Regeneration. Oft mit Tanztee und Kurschatten, man kam mal raus, sah was anderes und konnte sich verlieben oder flirten. Auch weil soziale Schranken aufgehoben waren oder anders gewichtet wurden.
Es gab und gibt auch Profipatienten, die den anderen das Spiel erklären. Sie sind immer wieder im Krankenhaus und in der Reha, aus diversen Gründen. Die klassische Kur gibt es heute nicht mehr. An ihre Stelle ist die Reha getreten und damit ein nach besten Kriterien durchoptimiertes Programm, das einem hilft, schnell wieder Schritte zurück ins Leben zu machen. Straff organisiert, mit einem strengen Stundenplan, Teilnahme verpflichtend, sonst steigt einem die Krankenkasse aufs Dach. Da ist man abends geschafft. Der Einbruch der Anderswelt wird reduziert, man kommt dem immer näher, was man aus dem normalen Leben ohnehin kennt, andauernd im Dienst zu sein, nun auch in der Reha.
Die Kur war anders, eine Bastion der Anderswelt, des Außeralltäglichen, was ansonsten in den Bereich des religiösen Rituals und der Kunst gehört. Das ist auch eines der Probleme, wir brauchen diese anderen Bereiche, diese Auszeiten, diese Brüche mit der Normalität. Noch ein wenig anders geworden ist es durch Smartphone und Internet. Manche führen ihre Beziehungen so und arbeiten im Home Office, da wird beim Aufenthalt in Krankenhaus oder Reha die Distanz zum Gewohnten, der eigenen Blase mit der man verbunden ist, immer geringer. Raucherecke, Zimmernachbar oder Speisesaal kommen dagegen kaum noch an. Der Einbruch des seltsam Anderen der Krankheit in die Normalität wird immer geringer. Das ist auf der einen Seite sicher erwünscht, aber vielleicht ein Verlust, der uns jetzt noch gar nicht bewusst ist. Oder sehen wir bereits seine Symptome?
Der Arzt
Ich weiß nicht, ob die Beziehung der Deutschen zu ihren Ärzten normal ist. Zum Arzt zu gehen ist irgendwie ein deutsches Hobby. Weltweit belegen wir Platz 5, in Europa geht man in der Slowakei und Ungarn noch häufiger zum Arzt. Die regionale Über- oder Unterversorgung ist offenbar nicht der Grund für die Frequenz der Arztbesuche.
Seit längerer Zeit ist bekannt, dass in Deutschland sehr viele Operationen durchgeführt werden, auch sehr viele fragwürdige bis überflüssige, der Grund ist, dass man mit ihnen das meiste Geld verdienen kann, was ohnehin der immer stärker dominierende Aspekt im gesamten Medizinsystem ist.
Doch das Bild vieler Menschen in Deutschland von ‚ihrem Arzt‚ ist ein anderes. Es gab und gibt jede Menge Arztserien in Deutschland. Diese Bilder prägen zu einem nicht geringen Teil die Einstellung. Früher war der Arzt eine Respektsperson, man machte und unterließ, was er einem auftrug. Vielleicht tat die Gott in Weiß Pose den Ärzten selbst nicht gut, seit einigen Jahren wird der Arzt für immer mehr Menschen zu einer Art Partner, doch bisweilen dreht sich hier der Spieß schon um, weil immer mehr Menschen mit Hilfe des Internets selbst ihre Symptome diagnostizieren und das Ergebnis ist für alle Beteiligten nicht immer erfreulich. Den Selbstdiagnostikern fehlt die Erfahrung und die Distanz. Die eigenverantwortliche Einbindung des Patienten in seinen Genesungsprozess, vor allem, bei chronischen oder schweren Erkrankungen ist hingegen sehr hilfreich. Das alles wird sich neu ausbalancieren.
Ein bisschen wird die Anderswelt durch Patienten gefördert und durchbrochen, die aus sozialen Gründen zum Arzt gehen, weil sie keine Angehörigen haben oder in dauernder hypochondrischer Sorge leben. Der Arzt ist dann oft der einzige Mensch, der ihnen zuhört, man sollte sich vorstellen können, dass es hier bessere Lösungen gibt.
Esoteriker, Alternativmediziner, Anthroposophen, Heilpraktiker und Homöopathen: Medizinskepsis hat Tradition
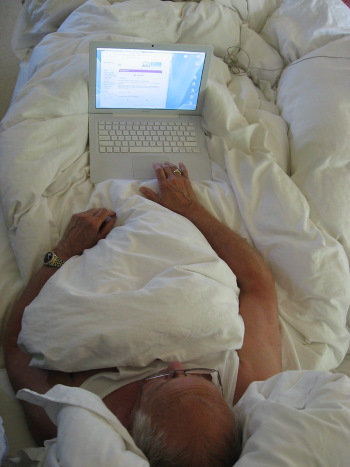
Kranksein im Bett in heutigen Zeiten. Die Normalität wird oft ungerührt fortgesetzt, zumindest wird es versucht. © Kai Hendry under cc
Nicht nur die seltsame Glorifizierung von Ärzten hat in Deutschland Tradition, auch eine mitunter intensive Skepsis bis Abneigung gegen das medizinische System. Der Sprachraum, Traditions- und Wirkungsbereich von Virchow und Sauerbruch, ist auch der von Hahnemann, Steiner, Bruker und anderen.
Schon vor Jahrzehnten wurde in den öffentlich-rechtlichen Enthüllungsjournalen immer wieder über Heilpraktiker berichtet und die Gefahr, durch ihre angebliche oder tatsächliche medizinische Inkompetenz. Schon das wäre ein Thema für sich. Alle zehn Jahre entdeckt ein Apotheker aufs Neue, dass in homöopathischen Mitteln ja oftmals gar nichts drin ist, große gedruckte Wochenmagazine unterstützen auffallend häufig die Stoßrichtung und die Rede vom Betrug auf allen Ebenen.
Dessen ungeachtet machen die Heilpraktiker und Ärzte, aus dem, im weitesten Sinne, alternativmedizinischen Spektrum einfach weiter und die Patienten bleiben ihnen treu. Seltsam ist, dass die Kritik aus alternativen Reihen just dann laut und gehört wurde, als sich die Medizin in einem Höhenflug befand, Anfang der 1970er. Die Antibiotika waren neu, wirkten, die Nebenwirkungen und Resistenzen waren noch kein Thema, mit Impfprogrammen gelang es große Krankheiten auszumerzen oder stark einzudämmen, die Kombination aus Forschung und Technik hatte den ersten Menschen eben auf den Mond gebracht, Forschung und Geld sollten, so war man überzeugt, dann auch ausreichen, um der letzten großen Geißel der Menschheit, dem Krebs, den Zahn zu ziehen.
In dieser Zeit hörte man auf einmal von dem späteren ‚Ernährungspapst‘ Max-Otto Bruker, dessen grundlegendes Buch Unsere Nahrung – unser Schicksal inzwischen schon die 50 Neuauflagen gesehen hat. Der junge Thorwald Dethlefsen begann sein esoterisches Weltbild zu verbreiten, es gab Homöopathen, Anthroposophen und immer mehr Menschen, die mit diesen Grundideen etwas anfangen konnten.
Der Streit entbrannte zwischen zwei Lagern, die unterschiedliche Vorstellungen von Heilung, Krankheit und Gesundheit hatten. Für die eine Fraktion, die dann durchaus immer liebloser und abwertender als Schulmedizin bezeichnet wurde, war Heilung alles in allem die Wiederherstellung des Normalzustandes Gesundheit. Und der ist erreicht, wenn der Mensch keine Symptome mehr hat. Krankheit, ist ein dummer Zufall, ohne jeden Sinn, eine biologische Fehlfunktion.
Für die andere Seite ist Heilung der Eintritt in eine kosmische Ordnung, in die wir alle eingespannt sein sollen. Krankheit ist das Verlassen dieser Ordnung und demzufolge hat Krankheit immer auch einen tieferen Sinn, eine Botschaft, eine Bedeutung.
Das total verunglückte Framing
Die Vertreter der Schulmedizin und ihre Lobbyisten waren immer schon der Auffassung, die weitaus besseren Argumente auf ihrer Seite zu haben. Man war vielleicht überrascht, dass sich das alternative Lager in einer Art unterirdischem Gangsystem vernetzte und hartnäckig blieb. So richtig aufeinander einlassen wollte man sich nicht. Die Auseinandersetzungen wurden härter und prinzipieller und so wurde die Abteilung Alternativmedizin mit dem Begriff ‚unwissenschaftlich‘ diskreditiert, was auf der anderen Seite jedoch zu der Gegenreaktion führte, dass unwissenschaftlich zu sein, fast als eine Auszeichnung begriffen wurde. Der Diskussion tat das nicht gut, in einem langen Artikel über Heilung sind wir der Geschichte recht umfassend nachgegangen.
Doch leider wurde es noch schlimmer. Als Protest in Deutschland noch von links kam und es einen Konsens gab, dass politisch rechtsaußen zu sein, ein ernsthaftes Problem sei, brachte man die Alternativmedizin immer wieder in einen emotionalisierenden und assoziativen Kontext, mit einer politisch sehr rechten Einstellung. Waren es eher Szientisten, die der Alternativmedizin pauschal Unwissenschaftlichkeit vorwarf, so war das zwar in ihren Augen die schlimmste Entwertung, aber die Reaktion der Anhänger und der Normalbevölkerung blieb gelassen.
Die Kritik man sei implizit rechtsradikal, wenn man Anhänger der Alternativmedizin sei, war um einiges bösartiger, weil das vor 20 bis 30 Jahren ein schwerer Vorwurf war. Unabhängig von irgendwelchen mehr oder weniger gelungenen Herleitungen, ist das Argument der impliziten Mithaftung, ein Non Sequitur, ein Fehlschluss. Die Hintergründe haben wir in Verschmelzungen und Einheitserfahrungen (2) näher beleuchtet.
20 bis 30 Jahre später ist Protest oft stark rechtslastig oder eben querdenkerisch und die Schreckstarre bei der Titulierung als Rechter tritt schon wegen der Gewöhnung kaum noch auf. Man steht da, fragt sich, wie und ob man noch mit einander reden sollte oder kann und wie es auf einmal sein kann, dass sich diese eigenartige Melange aus Esoterikern, Alternativmedizinern, Anthroposophen, mit Rechtsextemen und ‚ganz normalen Menschen‘ geben kann.
Die Skepsis, die dort spürbar wird ist nicht neu, man hat sie nur nie ernst genommen. Die Abqualifizierung als rechtslastig ist immer mehr Menschen zunehmend egal, weil sie sie teilweise bis zum Überdruss kennen. Hier fliegt der Bumerang auch jenen an den Kopf, die ihn irgendwann mal geworfen haben, ein völlig verunglücktes Framing.
Wer an den Hintergründen interessiert ist und die andere Seite wenigsten verstehen will, sollte sich die unterschiedlichen Vorstellungen von Heilung und die Implikation in einem lebendigen, sinnerfüllten Kosmos zu leben und Gegenposition anschauen, die von einer Fehlfunktion in einem letztlich sinnleeren Universum ausgeht. Die Linie verläuft keineswegs nur entlang politischer Lager. Aber diese grundlegend unterschiedlichen Einstellungen haben auch einen Einfluss auf das Kranksein.
Eine andere Kultur des Krankseins
Wenn Krankheit nur eine zufällige biologische Fehlfunktion ist, dann ist mit der Beseitigung der Symptome die Krankheit beendet. Mehr gibt es über sie nicht zu sagen. Wenn Krankheit allerdings eine Form des Dialogs mit einem lebendigen Kosmos ist, dann erfordert dieser Ansatz eine Antwort. Das Symptom ist dann ein Hinweis, eine Warnlampe, die zeigen soll, dass etwas an anderer Stelle in Unordnung geraten ist. Symptome zum Verschwinden zu bringen wäre dann so angemessen, wie die Birne, die anzeigt, dass beim Auto das Öl alle ist, loszuschrauben. Das Licht ist nun wieder aus. Aber was stimmt jetzt?
Wenn es einfach wäre, gäbe es die Diskussion nicht. Bei den Praktikern der neuen Generation ist man längst Schritte aufeinander zu gegangen. Selbst wenn man privat wenig mit einer Methode anfangen kann, hört man oft ein nicht abwertend gemeintes: „Wenn es Ihnen hilft, dann machen Sie es ruhig.“ Aber neben einem freundlichen Desinteresse gibt es auch echte Kooperation, zuweilen verschmilzt das Beste aus beiden Welten.
Wenn mein Kranksein kein dummer Zufall ist, sondern einen Sinn hat, wäre es gut, ihn zu finden. Wenn es erst mal nur die Anerkennung wäre, aus dem Hamsterrad heraus zu kommen und in eine andere Welt einzutreten, in einen Raum, in dem ganz andere Regeln gelten, das wäre auch schon mal was. Diese seltsame Umkehr sehen wir sehr häufig. Etwa bei Diskontinuitäten in der Partnerschaft, die von beiden nicht groß bemerkt und reflektiert werden. Es kann sein, dass in einer Beziehung der Mann stark dominiert, seiner Frau die Welt erklärt und was sie zu tun zu lassen hat. Im Falle einer Erkältung leidet der große Welterklärer schwer, seine Frau verwandelt sich in eine resolute Krankenschwester, die ihm erklärt, wie er sich zu verhalten hat, er folgt brav und wenn der Spuk vorbei ist, kehren sich die Rollen erneut ins Gewohnte um, als sei nichts gewesen.
Gesellschaftlich kennen wir so eine Rollenumkehr im Karneval. Oder bei angleichenden Regressionen im Stadion. Es zählt für eine gewisse Zeit nur noch, dass unser Verein gewinnt. Man geht aus sich heraus, jubelt, schreit, pöbelt, weint, umarmt fremde Menschen, der Alkohol hilft, wie im Karneval. Auf einmal ist alles, was eben noch gegolten hat unwichtig. Wenn man jünger ist, kann man die Nacht durchtanzen, alle zum gleichen Rhythmus, mit oder ohne Drogen. Am nächsten Tag sieht das wieder anders aus, aber die rituelle Auszeit ist gut.
Krankheit macht die Menschen auch gleich. Auf einmal ist man ein Patient neben anderen, gehört von jetzt auf gleich zur Gruppe derer, die eine Autoimmunerkrankung haben oder einen Schlaganfall. Manche Diagnosen ändern alles im Leben und spülen alle Werte und Ziele einmal kräftig durch. Von jetzt auf gleich ist alles anders, alle großen Pläne sind dahin, dafür werden vermeintliche Selbstverständlichkeiten auf einmal wichtig. Man sieht das Leben mit ganz anderen Augen.
Plötzlich tritt das, von dem man wusste, dass es existiert ins Bewusstsein, die existentiellen Situationen des Lebens erfassen einen. Die neue Wohnungseinrichtung, der nächste Urlaub, die Beförderung, all das verblasst. Unglaublich intensiv und erschütternd. Dann beginnt ein anderes Leben, mit anderen Zielen – wenn man neue findet – und oft auch ein ganz anderer Umgang mit Zeit, wie da oben, auf dem Zauberberg.
Gottfried Benn verdichtete diesen existentiellen Horror in Gedichten von Krebsbaracken und versucht ihn vielleicht zu verarbeiten, auf seine Art. Es stinkt, blutet und verwest. Der Mensch ist ja immer auch ein Mitleidender und muss irgendwie damit klarkommen. Da ist er wieder, der Arzt, dieses mal in einer ganz anderen Rolle, als der altväterlichen aus der Vorabendserie.
Das Kranksein des Erleidenden
Wie und was ist es nun wirklich, das Kranksein des Erleidenden? Ein Weg, eine Funktionsstörung? Es hängt wohl stark davon ab, was der einzelne Mensch darin sieht, darin sehen will. Wer Krankheit für eine Funktionsstörung und ein Glücksspiel hält, geht öfter zur Vorsorge, denn treffen kann es jeden, jederzeit oder nach den Erkenntnissen der Statistik. Also gilt es früh zu erkennen, woran man ist, das steigert die Chancen im großen Glücksspiel.
Wer an Schicksal glaubt, der ist oft unvorsichtiger, aber nicht irrational. Es ist schon folgerichtig dann zu denken, dass es den trifft, den es treffen soll. Wenn man dann getroffen wurde, geht man oft besser mit dem Schicksalsschlag um, denn alles hat ja seinen Sinn.
Aber das Spektrum ist in beiden Lagern breit und überlappend. Wer nicht an Schicksal glaubt, wird manchmal zum Kontrollfreak, was sich bis zur unverrückbaren Hypochondrie steigern kann. Denn man ist ja immer und für alles selbst verantwortlich und wer kann einem schon garantieren, dass nicht unmittelbar nach dem negativen Befund der Krebs ausbricht? Also auf zur nächsten Untersuchung und nach einer Zeit kann man auch noch die berechtigte Angst haben, dass durch die Untersuchungen eine schlimme Krankheit ausbricht oder gar durch die Angst vor ihr. Kafka live, verschiedenste Wege, aber garantiert kein Ausweg.
Der Hypochonder hat am Ende stets Recht, denn irgendwann wird er tatsächlich sterben … und genau das hat er immer schon gewusst. Aber ist der letzte Triumph das alles wert? Man kann halt nicht anders, weil niemand einem die 100% Garantie geben will und kann. Böserweise fangen die Ängste zumeist in jungen Jahren an, paranoide Sorgen, die nicht zu erlösen sind, treffen sich mit narzisstischen Inhalten, in denen man sich allen überlegen fühlt, weil man eben besser weiß, dass man sehr wohl in akuter Gefahr ist.
Aber das narzisstische Kreisen um sich selbst, um die eigenen Symptome und Befindlichkeiten kann auch locker das Lager von Sinn und Bedeutung erfassen. Was will mir dies sagen, was will mir das sagen? Alles nur für mich gemacht. Der zweite Schritt, dass jeder andere auch im Zentrum seines Bedeutungskosmos steht, wird meist nicht mehr gemacht, sondern vom anderen verlangt, meinen als wichtigsten zu setzen. Der heilsame Schritt, im größeren Ganzen aufzugehen, wird dann wiederum heftig von jenen bekämpft, die mit dieser Idee nichts anfangen können und wollen. Sie wollen dann alle in ihren Bedeutungskosmos zwingen.
Doch oft genug gelingt es, aus dem Kranksein etwas mitzunehmen. Weil Krankheit oft ein anderes Leben erzwingt, ist sie ohnehin ein Weg. Beim Schnüpfchen lohnt es vielleicht nicht, den ganz großen Besteckkasten auszupacken, aber je chronischer, vielleicht desto mehr. In jedem Fall kann es der Eingang zu einer ganz eigenen, seltsam faszinierenden Welt sein.
Quellen:
- [1] Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke, Krankheit als Weg, Bertelsmann 1983, S.82
- [2] Von Claudia Liebram, Teresa Nauber, Nur jeder zwanzigste Mensch ist wirklich gesund, Veröffentlicht am 09.06.2015, https://www.welt.de/gesundheit/article142167267/Nur-jeder-zwanzigste-Mensch-ist-wirklich-gesund.html