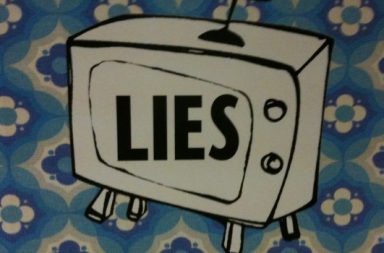Solidarität

Rechte Protestdemos verängstigen viele. © opposition24.de under cc
Doch die Entsolidarisierung ist falsch. Wir müssen uns zumuten zu erkennen, dass viele Menschen unverschuldet in prekären oder annähernd prekären Verhältnissen leben. Es ist die Angst richtig hinzuschauen und zu erkennen, dass es jeden treffen kann, oft auch unverschuldet, etwa wenn man vom Partner verlassen wird, die Firma pleite macht, man körperlich oder psychisch erkrankt, weil man den Druck nicht mehr aushält. Das kann einen alles schneller treffen, als einem lieb ist, unverschuldet.
Auch wenn man meint, dass Leistung sich lohnen sollte, muss man sich dennoch fragen, was Leistung heißt. Es gibt zwei Extreme. Das eine ist, dass es hoch- und niederwertige Arbeit gibt und dass der, der mehr verdient, es zurecht tut, weil er mehr verdient. Doch diese Begründung ist zirkulär. Hochwertigkeit definiert den Lohn und der die Hochwertigkeit. Das andere Extrem stammt von Marx, der sagt, dass eine Stunde Arbeit eine Stunde Arbeit und damit Lebenszeit ist, egal ob man die Straße fegt oder eine komplizierte Operation am Herzen durchführt. Das Gegenargument ist hier oft das der Qualität, dadurch definiert, dass die Straße im Zweifel jeder fegen kann (auch der Operateur), aber der Straßenfeger kann nicht operieren. Auf der anderen Seite, sollte doch im idealen Fall jeder machen, was ihm liegt und dafür muss man nicht noch bestraft werden.
Das allgemeine Empfinden fängt das insofern auf, als wir sowohl Fleiß, aber auch Talent oft belohnen und das in den meisten Fällen einigermaßen fair finden. Doch Leistungen sind es auch, Kinder groß zu ziehen, die Eltern zu pflegen oder ein guter Freund und für andere da zu sein, Geld gibt es dafür nicht, aber immerhin Anerkennung, auch dafür tun wir viel.
Der springende Punkt scheint zu sein, dass man einen genügend großen Abstand zwischen denen, die arbeiten und jenen, die das nicht tun, beibehält und den Teil in uns, der keine Trittbrettfahrer mag, zu besänftigen. Auf der anderen Seite hörte ich schon vor Jahren von einer Untersuchung eines Psychologen aus den USA (ich glaube, es war Michael Stone) der herausfand, dass Menschen, die von Sozialhilfe leben sich dann motiviert fühlen zu arbeiten, wenn sie das 1,5-fache dessen durch ihre Arbeit bekommen, was sie aus der Sozialhilfe erhalten. Beide Aspekte passen ganz gut zusammen, weil der monetäre Anreiz dafür sorgen wird viele in Arbeit zu bringen, die könnten, aber nicht wollen und das sollte uns auf der andere Seite dazu bringen uns stärker mit denen zu solidarisieren, die tatsächlich nicht können. Sie brauchen unsere Hilfe und die Ansicht, dass der Wert einer Gesellschaft sich daran bemisst, wie es den Schwächsten in ihr geht, ist meines Erachtens nicht der schlechteste Ansatz.
Ein anderes Argument ist das Bürgergeld oder bedingungslose Grundeinkommen. Oft wird diskutiert, wie und ob das finanzierbar sei und ob die Menschen dann noch arbeiten gehen würden und in der Tat gibt es hier mehr berechtigte Detailfragen, als den Befürwortern lieb sein kann. Moralisch setzt das Grundeinkommen aber auch an einer hohen Stelle an, nämlich bei der Vorstellung, dass wir Menschen ein würdevolles Leben ermöglichen können sollten, in dem sie nicht nur eben überleben, sondern an der Kultur noch teilhaben können. Hier wird der Wert eines Menschen auch monetär dargestellt und ausgezeichnet, aber diese an sich schöne Lesart hat das Problem, dass nicht alle dieses Empfunden teilen und es oft so empfunden wird, als würde davon die Falschen profitieren. Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung das Grundeinkommen abgelehnt.
Es gibt ein ganzes Bündel von Gründen, warum das so ist, aber alles in allem kann man sagen, dass die linken Bewegungen heute zahnlos geworden sind. Die Grünen haben den Durchmarsch von der Turnschuhpartei bis ins Establishment geschafft, die Agenda 2010 der SPD ist bei den sozial Schwachen durchgefallen und die Linkspartei konnte nie davon profitieren, dass Deutschland ungerechter wird.
Protest ist heute rechts
Den Protest übernehmen heute rechte Bewegungen, die viele Ressentiments aufgreifen und das Establishment und die Eliten frontal angreifen. Sie haben den Vorteil, dass sie oft nicht zu den Eliten gehören oder wenn, dann den Elefanten im Porzellanladen geben. Provozieren, anecken, Grenzen überschreiten, so machen es alle Protestparteien. Sie sind erfolgreich, weil sie einerseits die Ressentiments der „kleinen Leute“ auffangen, die sehr genau wissen, wer mit ihnen um sozialen Wohnraum, Geld und Beschäftigungsverhältnisse im Niedriglohnsektor konkurriert und andererseits einen Schuldigen für diese Misere anbieten, die Eliten des Landes.
Elite ist dabei zu einem Begriff verkommen, von Leuten, die sich die eigenen Taschen vollstopfen, während sie sich für die Sorgen und Nöte der kleinen Leute nicht nur nicht interessiert, sondern ihnen auch noch moralische Vorhaltungen macht. Das macht viele richtig wütend und es schließt die Reihen, denn wenn sich jemand nur oft genug in die rechte Ecke gesteckt wiederfindet, obwohl er so nie empfunden hat, sondern sich einfach übergangen fühlt, sagt er sich beim fünften Mal vielleicht: „Dann bin ich eben rechts.“
Damit ist man dann aber wer, sogar jemand der einigen Einfluss hat, einfach dadurch, dass man dazu gehört und den Etablierten, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollten vor allem Angst machen kann. Andere gehen an das Phänomen ganz taktisch heran. Sie teilen die Ideen der Rechten zwar nicht, haben aber gemerkt, dass sonstige Versuche zu protestieren und Gehör zu finden, folgenlos verpufften. Wer rechts ist hat auf einmal wie Identität. Wird von jemandem der sich nicht wahrgenommen fühlte zu jemandem, der wenigstens gefürchtet wird.
Wer das versteht, versteht auch, wieso sich einige Migranten der dritten Generation radikalisieren. Die haben doch hier alles, statt dankbar zu sein, werden sie irre, ist die allgemeine Ansicht. Und auch vor ihnen hat man Angst und auch sie beachtet man erst in ihrer neuen Rolle. Vorher erfüllte man brav die Regeln der Gesellschaft, hatte aber dennoch das Gefühl nicht dazu zu gehören, weil man Ausländern oder Moslem ist. „Dann bin ich eben Islamist.“ Islamisten und Rechte drehen die Bedeutung um, manchen aus dem einstigen Makel eine Auszeichnung, vermischen dies mit Elementen der Jugend- und Subkultur, hier Hooligans, dort Rapper und beide können ausgezeichnet die neuen Medien nutzen. Das was man all die Jahre abgesprochen bekam oder noch suchte, hat man jetzt: Eine Identität, eine soziale Rolle.
Entsolidarisierung schafft eine Identität
Damit ist es nicht nur so, dass Solidarität eine Identität und ein Wir schafft, sondern der einfachere und prägnantere Weg ist, sich zu entsolidarisieren. Wer hat sich denn all die Jahre für uns interessiert? Woher kommt auf einmal das Geld, was für uns angeblich nie da war, aber dann sprudelt, wenn es um Bankenrettung, Griechenland oder Flüchtlinge geht? Jahrelang war man einer von vielen, die nicht weiter auffielen, die man vergessen hatte, von denen man auch nichts wissen wollte. Wendeverlierer, Prekariat, sozial Abgehängte, die ihrerseits dem Staat längst gekündigt hatten und einfach nicht wählen gingen und irgendwie ihr eigenes Leben lebten. Abgehängt, vergessen, verleugnet.
Aus mitunter verständlichen Frust und Wut erwächst ein neues Gefühl, wenn man wieder eine neue Identität hat. Aus Ohnmacht wird im Handumdrehen Macht. Man muss nicht mal auf die Straße gehen, Protest kann heute auch von PC aus passieren. Hatespeech, Hassmails, das kommt umso mehr an, je abstoßender es ist und es hat sich irgendwie längst verselbstständigt. Der Wunsch nach Aufmerksamkeit und das Wissen darum, wie bequem es mitunter ist, sie zu bekommen ist längst Teil unserer kulturellen Gewohnheiten. Nein, das Internet ist gewiss keine Parallelwelt, kein Abklatsch der Realität irgendwo das draußen, die virtuelle Welt ist längst Teil der Realität und sich hier auszutauschen ist nicht weniger real oder emotional aufwühlend, wie eine Begegnung in der realen Welt, die stets auch mit Elementen der Phantasie durchsetzt ist.