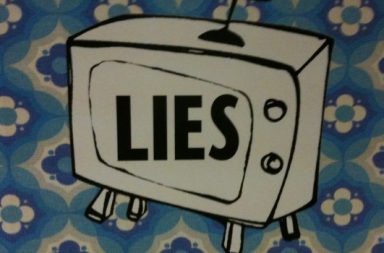Wahrheit und Fake news

Trist, aber oft auch schön und beschaulich: die Provinz. © Thomas Kohler under cc
Es ist seit Jahren bekannt, dass man ein und dieselben Daten, denen oft schon zu unrecht unterstellt wird, es seien Fakten von Relevanz, die keinen Widerspruch duldeten, so und so interpretieren kann, eine Turnübung, die man in der Flut besserer und schlechterer Talkshows mehrmals pro Woche erleben kann, wenn man will.
Aber was ist nun die Wahrheit? Dass es uns gut geht? In Deutschland und Europa sowieso, weltweit aber auch? Wie kann es zu dieser immensen Schere der Deutung kommen, zwischen einem unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang und einer Welt, die nie so frei und gut war, wie heute?
Das eine ist die Statistik, dass andere die Einzelfälle. Der Vorteil ist, dass die kulturelle Identität auch dann, wenn man nicht so ganz dazu gehört, stabilisierend wirken kann. Umso problematischer, wenn man sich nicht zugehörig fühlt, sondern an den Rand gedrängt und ausgegrenzt:
- Da ist die alleinerziehende Mutter, die, weil sie möchte, dass es ihrem Kind gut geht, arbeitet, für Nachhilfe, Kindermädchen und schicke Klamotten sorgt, gleichzeitig aber noch die einzige Tochter einer dementen Mutter ist, die sie nicht im Stich lassen will. Freizeit, Privatleben?
- Da ist die Lebensrealität der deutschen Provinz. Der Provinzbegriff ist, wie vieles, sehr relativ, aber die größere Zahl der Menschen wohnt eher in Kleinstädten ländlichen Regionen und das Leben in den Großstädten und Ballungszentren ist auch nicht 24/7 flirrend und elektrisierend. Aber dort in der Provinz spielen anderen Themen eine Rolle als im medial aufgeheizten Berlin. Und wir werden am Ende sehen, dass der vermeintliche Nachteile oft gar keiner ist.
- Da ist der Migrant der dritten Generation, der perfekt Deutsch spricht und integriert ist, aber das Gefühl hat eben nicht dazu zu gehören, wobei er die stillschweigend geforderten Bedingungen alle erfüllt hat. Seine Arbeit ist erledigt, trotzdem hat er das Gefühl abgelehnt zu werden. Oft nicht zu unrecht.
- Da ist die Durchschnittsfamilie, der Paradefall der deutschen Lebensart, die, wenn es um das Thema Rente geht, Sorgenfalten auf der Stirn bekommt. Wird schon, einfach nicht drüber nachdenken, Vertrauen haben?
- Da sind jene Ostdeutschen, die das Gefühl haben, von den blühenden Landschaften nicht so viel mitbekommen zu haben, nie viel Solidarität erfuhren, sich nun aber selbst solidarisch zeigen sollen.
- Da ist die junge Geisteswissenschaftlerin, mit toller Qualifikation, die in Praktika und schlecht bezahlten, befristeten Verträgen in einer Dauerwarteschleife angekommen ist und nach und nach verheizt wird.
- Da ist der spezialisierte Ingenieur, dessen Firma eine Sparte einfach schließt und der nun schon so alt ist, dass er für andere Firmen, die ihre spezialisierten Mitarbeiter suchen, nicht mehr attraktiv ist.
- Da ist der Hartz 4 Empfänger der Arbeit sucht und in demütigender Weise jeden Mist annehmen muss und dessen Neigungen, Stärken und Wünsche bei dem Spiel einfach nicht interessieren.
- Da ist der Maurer, der jetzt schon kaputt ist und sich fragt, wie er die letzten Jahre bis zur Rente, ohne große Abzüge zu bekommen, durchhalten soll.
Alles nur oberflächliche Skizzen von Einzelfällen, aber diese Einzelfälle werden mehr und ihre Stimmung wird schlechter, weil die Aussichten nicht rosig sind. Wenn die Erfolgsmeldungen der immer besseren, reicheren, gebildeteren, gerechteren Welt in zu große Diskrepanz zu den Alltagserfahrungen gerät, wird man irgendwann misstrauisch. Statistisch gesehen werden wir immer älter, reicher, glücklicher, gebildeter und haben obendrein noch so viel Zeit wie nie. Schöner kann es nicht nicht sein, in der Welt der Zahlen.
Das kaputte Wir ist jener Teil von uns, der empfindet, dass wir immer gehetzter sind, Familienplanung schwer ist, weil befristete Arbeitsverhältnisse keine Sicherheit bieten. Jener Teil des sich im unausgesetzten Konkurrenzkampf befindet, wenn er nicht resigniert hat, der über das Thema Rente lieber nicht nachdenkt oder es sind jene Alten, die Angst davor haben ein Pflegefall zu werden. Aus eigene Motiven und weil sie ihren Kindern nicht zur Last fallen wollen.
Der sichere Arbeitsplatz ist heute längst Geschichte, denn wenn früher ganze Generationen Kruppianer oder dergleichen waren und es sicher war, dass man, einmal dort, den Arbeitsplatz bis zur Rente behielt, so kann es heute schnell passieren, dass selbst Big Player Stellen abbauen, im großen Stile umstruktutieren und ganze Sparten schließen. Dazu kommt, dass man das Gefühl hat, dass man viele Probleme nicht los wird.
Längst überwunden geglaubte Themen verfolgen uns erneut oder immer noch. Der kalte Krieg, Religionskonflikte, die Angst vor Terror, innerer Sicherheit und der Klimawandel. Krebs und Herz-/Kreislauferkrankungen sind keinesfalls besiegt, bei den Seuchen meint man, sie könnten wieder kommen und die nächste Generation wird es in sehr vielen Fällen nicht besser haben, sondern ziemlich sicher schlechter dran sein, in den Vereinigten Staaten sinkt sogar die Lebenserwartung wieder. Eine rosige Zukunft sieht anders aus.
In diesem Klima ist die Einstellung „Nach mir die Sintflut“ gar nicht schlecht, zumindest um selbst mit diesen Aussichten klar zu kommen. Psychisch ist es allemal besser, ein klares und erreichbares Ziel vor Augen zu haben, statt den Status Quo verbissen und ängstlich zu verteidigen. Das kaputte Wir ist jener Teil von uns, dem es tatsächlich nicht besser geht und der mit den kollektiven Erfolgsmeldungen nichts anfangen kann und sich eher sogar noch betrogen fühlt. Doch das vermutlich alles überragende Thema ist derzeit ein anderes:
Gerechtigkeit
Das kaputte Wir ist zu einem sehr großen Teil eine Folge empfundener Ungerechtigkeit. Dabei geht es gar nicht darum ob man selbst zufrieden ist, denn das sind sehr viele, an ihnen nagt viel mehr die Idee, dass sie in einer ungerechten Gesellschaft leben. Wir sind nämlich gar nicht so egoistisch, desinteressiert und bösartig, wie man zuweilen hört, wir sind nicht primär egoistisch, sondern ultrakooperativ.
Besser als Menschen zu erklären, wie sie zu denken und zu fühlen haben und ihnen dann vorzurechnen, dass sie falsch empfinden, ist es, sie nach ihrer Vorstellungen zu fragen. Das wurde in der Studie gemacht, die dem oben verlinkten Artikel zugrunde liegt. Ergebnis: Den weitaus meisten Befragten geht es gut, dennoch haben sie das Gefühl in einer ungerechten Gesellschaft zu leben und das finden sie nicht gut. Doch Gerechtigkeit ist keine Gleichmacherei, auch nicht in den Augen der Befragten:
„Denn offenbar verstehen viele Angehörige der sogenannten Generation Mitte unter sozialer Gerechtigkeit und dem Weg dorthin etwas anderes als die Linke und die linken Flügel von SPD und Grünen. Deren klassisches Rezept lautet: Nehmt den Reichen und gebt es den Armen. Doch das ist für die Befragten offenbar nicht das Mittel der Wahl für eine gerechtere Gesellschaft.“[2]
Genau hier ist das Problem, denn mehr Mitgefühl mit den sozial Schwachen würde helfen. Das ist aber bei den Befragten nicht erwünscht. Ihre Ansicht ist, dass Leistung sich lohnen muss und dass unterschiedliche Leistungen auch spürbar werden sollten. Zudem glauben die meisten, dass sich Arbeit lohnen muss und man davon leben können sollte. Das scheint ein typisch menschlicher Punkt zu sein und ich glaube er wäre in Praxis umsetzbar.
Typisch menschlich ist die Entwicklung Trittbrettfahrer abzuhalten. Typisch menschlich deshalb, weil es den Menschen von seinen Primatenverwandten unterscheidet, die Trittbrettfahrer agieren lässt.[3] Mit Trittbrettfahrer ist hier jemand gemeint, der zum Beispiel bei der Jagd keine Rolle gespielt hat, aber Nahrung beansprucht. Schimpansen lassen Trittbrettfahrer gewähren, die Menschen nicht. Sie setzen auf Partnerschaften, die sich aus den Fähigkeiten und Eigenschaften bei der Nahrungssuche ergaben, das sind die Fähigkeiten zur Kooperation, zum Teilen und eine gewisse Impulskontrolle. Sie reagieren vor allem allergisch darauf, wenn jemand nicht teilt oder Trittbrettfahrer ist und nicht mit macht, aber Ansprüche stellt.
Das ist tief in uns verwurzelt und wir mögen es auch dann nicht, wenn es uns selbst gut geht. Von vielen Menschen die Sozialleistungen empfangen nehmen wir an, dass sie Trittbrettfahrer seien, das heißt, wir haben die Idee, dass sie können, aber nicht wollen. Zweitens, kommt hinzu, dass wir uns mit den Armen nicht solidarisieren, aus eigener Abstiegsangst. Wenn man die Idee hat, dass die anderen etwas falsch gemacht haben, als sie abrutschten kann man sich immer noch einreden, dass man selbst pfiffiger ist. Das Gefühl, dass es jeden treffen kann, macht mich ohnmächtiger, eine Variante, die man nicht so gerne wählt.
Der Abstand zwischen denen, die für ihr Geld arbeiten und denen, die das nicht tun, soll sichtbar und deutlich bleiben. Offenbar ist das Gefühl, dass jemand einfach „nur so“ etwas bekommt, schwerer zu ertragen, als das Gefühl, dass jemand zu viel bekommt, auch wenn das die meisten auch nicht lustig finden. Wenn Michael Tomasello, mit seiner, von zahlreichen empirischen Studien unterfütterten These in seinem Buch „Eine Naturgeschichte der menschlichen Moral“ recht hat, dann ist der Mensch nicht dagegen, dass die Ärmeren mehr bekommen, weil er egoistisch und unsolidarisch ist, sondern, weil er gerecht ist und Unfairness nicht ausstehen kann.
Es ist schwer zu vermitteln, dass jemand jeden Tag für ein karges Gehalt arbeiten geht, während ein anderer fürs Nichtstun einen ähnlichen Betrag erhält. Hier ist auch der Vergleich unmittelbarer, während jemand der in drei Stunden mehr verdient als andere in einem Monat irgendwie in einer anderen Liga spielt.