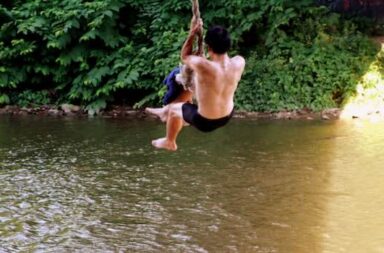Brain Fog fühlt sich an, als wäre ein dichter Nebel in deinem Kopf. Du bekommst deine Gedanken nicht mehr klar zu fassen und hast keinen richtigen Zugriff mehr darauf. Dein Gehirn scheint wie von Watte umgeben zu sein. Einige Menschen fühlen sich so, als wären sie gar nicht mehr richtig in dieser Welt – dissoziiert. Die Arbeitsaufgaben sind schwerer zu schaffen und erfordern mehr Zeit, der Alltag wird mühsam, Gespräche strengen an und selbst einfache Entscheidungen fallen schwer. Was viele nicht wissen: Brain Fog kann biologische und psychologische Ursachen haben und mitunter Ausdruck einer psychischen Überforderung sein, kein bloßes Konzentrationsproblem.
Brain Fog Symptome: Nebel im Gehirn
Zu den typischen Symptomen von Brain Fog, welche die meisten Menschen beschreiben, zählen:
- Konzentrationsstörungen, Denkblockaden: Die Gedanken schweifen ständig ab oder wirken wie eingefroren. Es fällt schwer, Aufgaben strukturiert und fokussiert zu bearbeiten.
- Geistige Verlangsamung oder „Leere“: Die mentale Verarbeitung wirkt gebremst, als würde das Denken in Zeitlupe ablaufen oder in manchen Momenten ganz aussetzen.
- Wortfindungsprobleme, Vergesslichkeit: Gewohnte Begriffe entfallen plötzlich, alltägliche Informationen werden übersehen – selbst einfache Erinnerungen scheinen schwer abrufbar.
- Emotionale Erschöpfung, Reizbarkeit: Innere Kraftreserven sind aufgebraucht. Schon kleinere Herausforderungen führen schneller zu Überforderung, Gereiztheit oder Stimmungsschwankungen.
- Gefühl innerer Abwesenheit oder Dissoziation: Man erlebt sich selbst wie von außen oder wie in Watte gepackt – als wäre man nicht ganz da oder innerlich abgeschaltet.
- Schwierigkeiten, präsent und aufmerksam zu bleiben: Es fällt schwer, im Moment zu bleiben. Gespräche, Geräusche oder Tätigkeiten werden nur noch teilweise oder verzögert wahrgenommen.
Diese Symptome sind nicht immer gleich stark ausgeprägt, doch sie haben eines gemeinsam: Sie erschweren es, klar zu denken und sich im Alltag verbunden zu fühlen.
Ursachen von Brain Fog: Das steckt dahinter

Normalerweise ist unser Gehirn klar und gut vernetzt im Denken – bei Brain Fog ist das jedoch nicht der Fall. ©
Jose Navarro under cc
Neben biologischen Faktoren können seelische Belastungen die geistige Klarheit beeinträchtigen.
Mögliche biologische Ursachen – kurz erklärt
Körperliche Faktoren können das Gefühl von „Nebel im Kopf“ hervorrufen oder mitbedingen. Zum Beispiel beeinflussen mitunter chronische, oft unbemerkte Entzündungen im Körper (silent inflammation) die geistige Klarheit. Auch kann Brain Fog in Zusammenhang mit Long COVID stehen.
Eine gute Nährstoffversorgung, zum Beispiel an Vitamin B12, Magnesium oder Omega-3-Fettsäuren, ist für die Gehirnfunktion essenziell. Hormonelle Ungleichgewichte (beispielsweise bei der Schilddrüse oder den Geschlechtshormonen) können sich ebenfalls negativ auf Konzentration und Stimmung auswirken. Eine gestörte Darmflora beeinflusst über die Darm-Hirn-Achse direkt das Nervensystem.
Schlafmangel sowie weitere Faktoren stehen oft in enger Wechselwirkung mit psychischem Stress und sollten daher bei anhaltenden Beschwerden mit abgeklärt werden. Auch Krankheiten oder Medikamenteneinnahme können Brain Fog-Symptome hervorrufen.
Es gibt eine Vielzahl an Gründen für den Gehirnnebel. In diesem Artikel beschäftigen wir uns jedoch mit möglichen psychologischen Ursachen von Brain Fog.
Psychische Faktoren für Brain Fog
Oft ist Brain Fog ein psychologisches Warnsignal: Das Nervensystem steht unter Druck, die Reizverarbeitung ist überfordert, das emotionale Gleichgewicht gestört. Die folgenden psychischen Faktoren spielen dabei eine zentrale Rolle und treten häufig in Kombination auf:
Chronischer Stress und Cortisol-Daueralarm
Haben wir dauerhaft Stress, Ängste und Sorgenkreisel, schaltet unser Nervensystem in den Überlebensmodus. Die Stresshormone Cortisol und Adrenalin halten den Körper in Alarmbereitschaft. Das geschieht auf Kosten kognitiver Funktionen wie Konzentration, Gedächtnis und Klarheit. Unser Gehirn priorisiert dann nicht mehr Denken, sondern Reagieren. Dauerhaft kann das zu geistiger Erschöpfung und Brain Fog führen.
Trauma und Dissoziation
Unverarbeitete psychische Belastungen, wie Kindheitstraumata oder emotionale Überforderungen, können zur Folge haben, dass sich das Gehirn teilweise „abschaltet“. Dissoziation ist ein Schutzmechanismus: Wenn Fühlen zu viel wird, blendet das Gehirn die Realität aus. Brain Fog kann in diesem Zusammenhang ebenfalls auftreten.
Reizüberflutung
Digitale Dauerverfügbarkeit, Multitasking – all das überfordert unser Arbeitsgedächtnis. Wenn zu viele Reize gleichzeitig verarbeitet werden müssen, schaltet das Gehirn auf Sparmodus. Das Ergebnis: mentale Trägheit, Unklarheit und innere Abwesenheit.
Emotionale Erschöpfung und Selbstentfremdung
Viele Menschen funktionieren im Alltag, ohne wirklich bei sich zu sein. Sie leben im Außen, verlieren das Gefühl für eigene Bedürfnisse. Brain Fog kann als Ausdruck für diese innere Entkopplung stehen und ein Hinweis darauf sein, dass der Kontakt zu sich selbst fehlt.
Was du gegen Brain Fog tun kannst
Brain Fog aufgrund von psychologischen Ursachen ist zwar belastend, aber in vielen Fällen nicht unveränderbar. Sobald du die möglichen Ursachen erkennst, kannst du gezielt gegensteuern. Psychotherapeutische Hilfe, kleine Veränderungen im Alltag, achtsamer Umgang mit Körper und Psyche sowie gezielte Entlastung des Nervensystems helfen, den Nebel im Kopf zu lichten und wieder präsenter, klarer und kraftvoller zu denken.
1. Nervensystem regulieren

Brain Fog kommt oft von emotionaler Erschöpfung. © Brendan Wood under cc
Der Vagusnerv ist ein zentraler Akteur in der Stressverarbeitung. Nicht wenige psychologische Fachleute vertreten die Auffassung, dass seine Aktivierung helfen kann, das Nervensystem zu beruhigen und geistige Klarheit zurückzubringen:
- Langsames Atmen (z. B. 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus): Diese Atemtechnik beruhigt das Nervensystem, senkt den Cortisolspiegel und hilft, aus dem Stressmodus auszusteigen.
- Summen oder Singen, um den Vagus zu stimulieren : Vibrationen durch Summen oder Singen aktivieren den Vagusnerv, was innere Ruhe und geistige Klarheit fördern kann.
- Kälteimpulse, etwa kaltes Wasser im Gesicht oder Wechselduschen : Kältereize sollen ebenfalls den Vagusnerv aktivieren und die Durchblutung fördern – ein schneller Weg, um geistige Frische zurückzugewinnen.
2. Monotasking statt Multitasking
Unser Gehirn arbeitet am effektivsten, wenn es sich auf eine Sache konzentriert. Plane gezielte „Deep Work“-Blöcke ein, ohne Ablenkung durch Handy oder E-Mails. Selbst kurze, klare Fokuszeiten sind wertvoller als stundenlanges Multitasking.
3. Mentale Entgiftung durch digitales Detox
Ständiges Scrollen, Reagieren und Konsumieren führt zu mentaler Übersättigung. Baue bewusst digitale Pausen ein, zum Beispiel eine bildschirmfreie erste Stunde am Morgen oder handyfreie Abende. Dein Gehirn braucht Leerlauf, um sich zu regenerieren.
4. Brain Dumping: Gedanken entladen
Ein einfacher, aber effektiver Trick gegen mentale Überforderung: Gedanken aufschreiben, frei heraus, ohne sie zu bewerten. Ob morgens zum Sortieren oder abends zum Entlasten: Ein Notizbuch hilft, die „mentale RAM“ zu entleeren und wieder Platz für Klarheit zu schaffen.
Neuroplastische Übungen, um Brain Fog zu reduzieren
Das Gehirn ist formbar, selbst nach stressvollen oder traumatischen Erfahrungen. Es gibt verschiedene Methoden, die dir dabei helfen können. Allerdings benötigen einige davon professionelle psychotherapeutische Unterstützung. Vor allem bei traumatischen Erfahrungen kann Selbsthilfe kontraindiziert sein und schwerere psychische Belastungen sowie emotional überwältigende Reaktionen hervorrufen. Deshalb ist es wichtig, bei starken psychischen Belastungen oder schwierigen Erlebnissen in der Vergangenheit professionelle psychotherapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ratgeber-Tipps aus dem Internet ersetzen keine individuelle Hilfe durch Psychotherapie und sind nicht zur Behandlung psychischer Erkrankungen und Traumatisierungen geeignet.
Beispielhafte neuroplastische Übungen wären:
EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing
EMDR nutzt bilaterale Stimulation, um belastende Erinnerungen zu verarbeiten und emotionale Reaktionen zu regulieren. In der Psychotherapie wird EMDR gezielt eingesetzt, um traumatische oder belastende Erfahrungen zu verarbeiten, die das Denken und Fühlen beeinträchtigen. Durch bilaterale Stimulation, beispielsweise durch Augenbewegungen, wird die Selbstregulation des Gehirns unterstützt. Das kann helfen, emotionale Blockaden zu lösen und den mentalen Nebel zu lichten.
Klassisches EMDR gehört in fachkundige Hände, da es tief sitzende Traumata reaktivieren kann.
Geführte Visualisierungen
Geführte Visualisierungen sind mentale Übungen, bei denen du mithilfe einer ruhigen Stimme angeleitet wirst und dir über innere Bilder gezielt stärkende, beruhigende oder klärende Szenen vorstellst. Sie eignen sich besonders gut zur Stressreduktion, Stabilisierung und zur Förderung von Selbstmitgefühl. Bei einem nichtklinischen Erscheinungsbild (also ohne Symptome von klinisch-relevanter Ausprägung) können sie auch ohne therapeutische Begleitung durchgeführt werden und unterstützen dich dabei, neue Denk- und Gefühlsmuster aufzubauen. Zudem fördern sie das Erleben von Selbstwirksamkeit. Besonders bei chronischem Stress oder emotionaler Erschöpfung können sie stabilisierend wirken.
Dein Gehirn verarbeitet innere Bilder ähnlich wie reale Erfahrungen – das macht geführte Visualisierungen so wirkungsvoll. Positive Visualisierungen beruhigen das Nervensystem und fördern neue, gesunde neuronale Verknüpfungen. Du trittst aus dem Grübel- oder Problemmodus heraus und begibst dich innerlich an einen Ort, der Ruhe, Sicherheit und Kraft ausstrahlt. Das stärkt die Verbindung zu deinem Körper und deiner Gefühlswelt.
So gehst du Schritt für Schritt vor

Ein gut funktionierendes Gehirn ist auch von der Psyche beeinflusst. © Anarchimedia under cc
Es gibt einige geführte Visualisierungen im Internet. Manchmal dauert es etwas, bis man die passende Methode für sich gefunden hat. Achte darauf, dass du dich auch bei diesen geführten Visualisierungen online „in professionelle Hände begibst“ und sorgsam mit dir umgehst.
- Wähle eine passende Anleitung: Nutze seriöse Audiodateien, Meditations-Apps oder YouTube-Kanäle mit ruhiger, strukturierter Führung und fachkundiger psychologischer Anleitung.
- Suche dir ein Thema aus, das zu deinem Zustand passt: Geeignete Inhalte sind z. B. „Innerer sicherer Ort“, Selbstmitgefühl, emotionale Stabilisierung oder Ressourcenstärkung.
- Schaffe einen geschützten Raum: Setze dich in eine ruhige, ungestörte Umgebung. Schließe die Augen, finde eine bequeme Sitz- oder Liegeposition, atme ruhig.
- Achte auf deine Reaktion: Beobachte während der Übung, wie sich dein Körper anfühlt. Wenn du dich unwohl fühlst oder dich überfordert fühlst – brich ab. Sicherheit steht an erster Stelle.
- Reagiere behutsam auf innere Bilder: Falls belastende Emotionen oder Erinnerungen auftauchen: Gehe nicht stärker hinein. Stattdessen hole dich sanft zurück in die Gegenwart, beispielsweise durch bewusstes Atmen, das Spüren des Bodens oder eine Hand auf deinem Körper (z. B. auf dem Herzen oder Bauch). Erwäge psychotherapeutische Unterstützung.
Beispiele für geführte Visualisierungen
Nachfolgend sind beispielhaft mögliche geführte Visualisierungen veranschaulicht.
- Innerer sicherer Ort: “Stell dir einen Ort vor, an dem du dich vollkommen sicher und geborgen fühlst. Vielleicht ein Platz in der Natur, ein Raum, den du liebst oder etwas ganz Fantasievolles. Was siehst du? Was hörst du? Was spürst du dort?“
- Selbstmitgefühl und innerer Beistand : „Sieh dich selbst als Kind oder als erschöpften Menschen – und stell dir vor, wie du dich liebevoll an deine eigene Seite setzt. Welche Worte der Fürsorge würdest du dir sagen?“
- Entlastung innerer Anspannung: “Spüre, wo du gerade Druck oder Enge im Körper empfindest. Mit jedem Atemzug schickst du Licht oder Wärme dorthin und beobachtest, wie sich etwas löst.“
- Stärkende Symbole oder innere Helferfiguren: „Lass vor deinem inneren Auge ein Bild auftauchen, das dir Kraft gibt – ein Baum, ein Tier, ein Licht. Wie fühlt es sich an, dieses Symbol in dir zu tragen?“
Wichtiger Hinweis: Visualisierungen sind keine „Wunderlösung“, sondern eine liebevolle Möglichkeit, dich selbst zu regulieren und innerlich zu stärken. Sie ersetzen keine Traumatherapie. Wie gesagt, bei tieferliegenden Belastungen oder starken Reaktionen solltest du dir psychotherapeutische Unterstützung holen.
Der wichtigste Maßstab bleibt: Fühlt sich die Übung sicher, stärkend und wohltuend an? Wenn ja, kannst du sie regelmäßig in deinen Alltag integrieren.
Fokus auf positives Denken
Auch ein bewusst positives Denken kann unser Gehirn dazu bringen, wieder mehr in „hellere Bereiche“ zu gehen. Es mag einfach klingen, ist aber in Teilen eine wirksame Strategie, allerdings nur bei moderaten wahrgenommenen seelischen Belastungen. Folgende Ansätze können hilfreich sein:
- Visualisierungen positiver Erlebnisse oder Zukunftsbilder : Wohin möchtest du? Was willst du erreichen?
- Affirmationen zur emotionalen Neuausrichtung: „Ich bin sicher.“, „Ich bin wertvoll.“ „Ich darf sein.“
- Fokustechniken, um die Aufmerksamkeit auf Dankbarkeit zu lenken: Bewusste Beschäftigung mit Dingen, die gute Gefühle auslösen (Zeit für Meditation, Yoga, Waldspaziergänge, Pausen einplanen). Dankbar sein für das, was gut ist im Leben, indem du beispielsweise jeden Abend aufschreibst, was gut gelaufen ist an dem Tag oder was dich zufrieden macht.
Brain Fog ist kein Versagen!
Brain Fog steht nicht für ein persönliches Versagen, sondern kann ein wichtiges Warnsignal sein. Aus psychologischer Perspektive kann der Gehirnnebel anzeigen: Dein System ist überfordert – psychisch, emotional, mitunter auch körperlich. Der erste Schritt zur Besserung ist nicht, dagegen anzukämpfen oder sich unter Druck zu setzen, sondern sich mit Selbstfürsorge hinzuwenden. Wenn du beginnst, auf den Nebel im Kopf zu achten – wann wird er stärker, wann klart er sich? –, kannst du Wege zurück zu Klarheit und innerer Verbundenheit finden. Berücksichtige, bei anhaltenden Beschwerden eine medizinische oder psychotherapeutische Abklärung in Erwägung zu ziehen. Ansonsten gilt: Du musst nicht perfekt funktionieren, sondern du darfst spüren, innehalten und dir erlauben, langsamer zu werden. Oft liegt die Lösung bei Brain Fog nicht im „mehr Denken“ oder „mehr Konzentrieren“, sondern im Wiederfühlen und sich selbst wieder mehr mit sich zu verbinden.
Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, Protokollierung der Anmeldung und deinen Widerrufsrechten erhältst du in unserer Datenschutzerklärung.